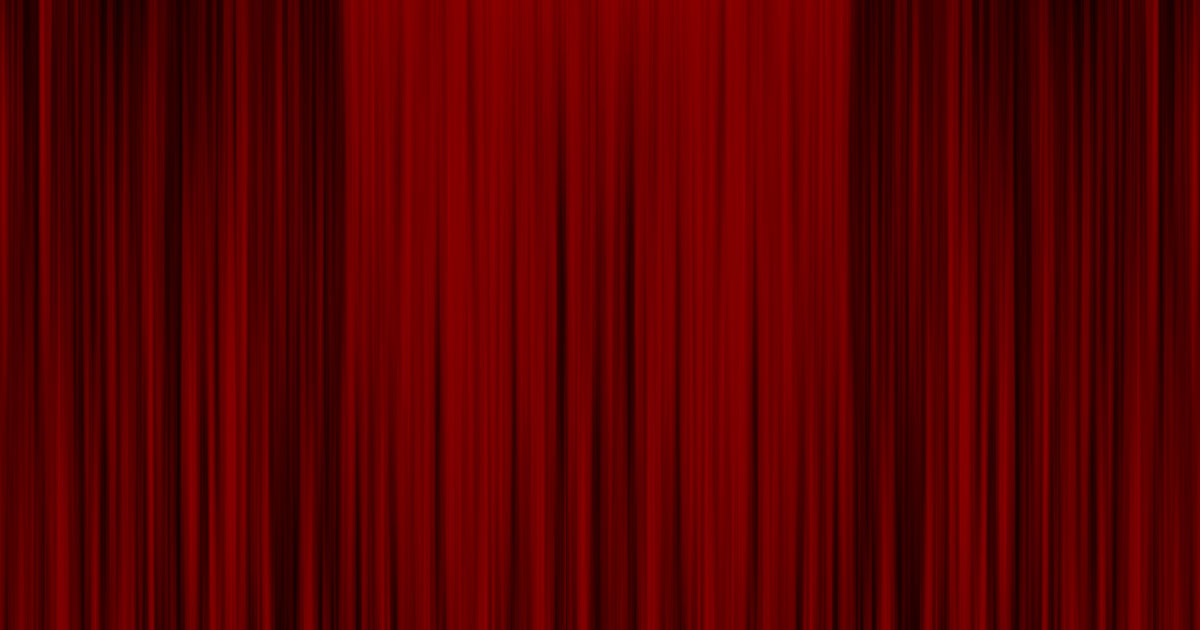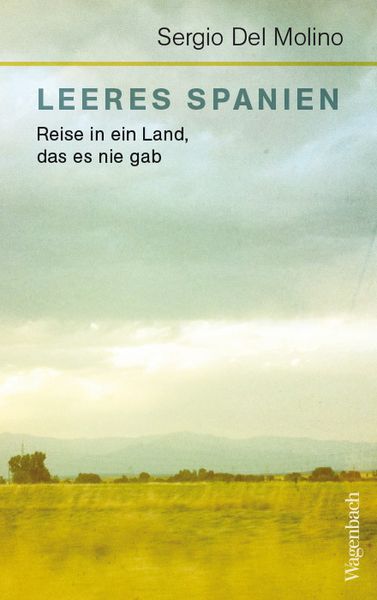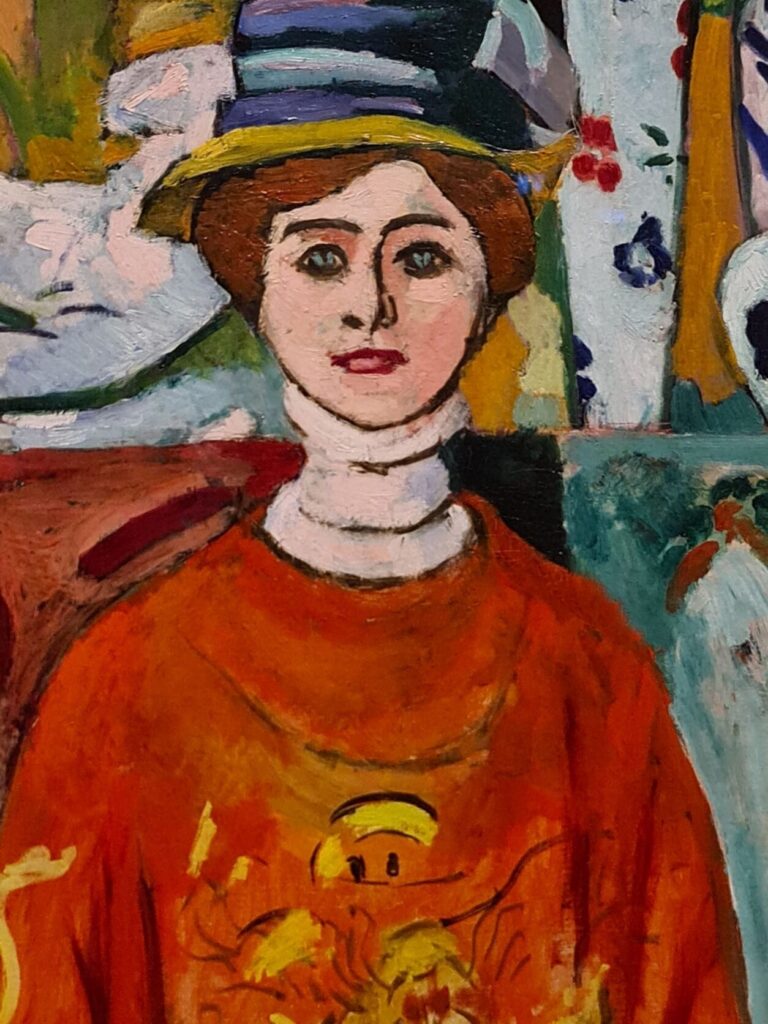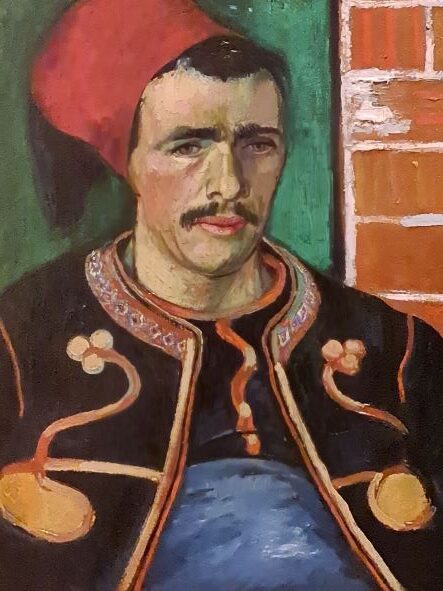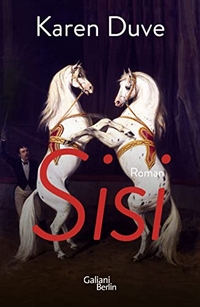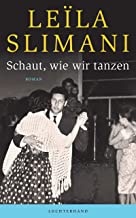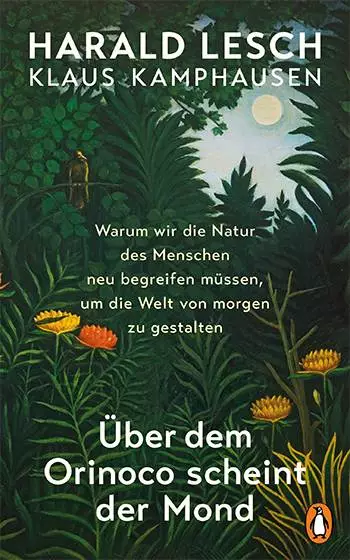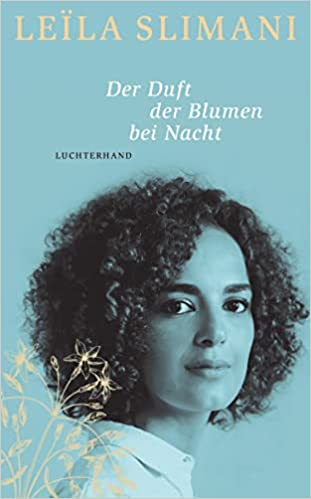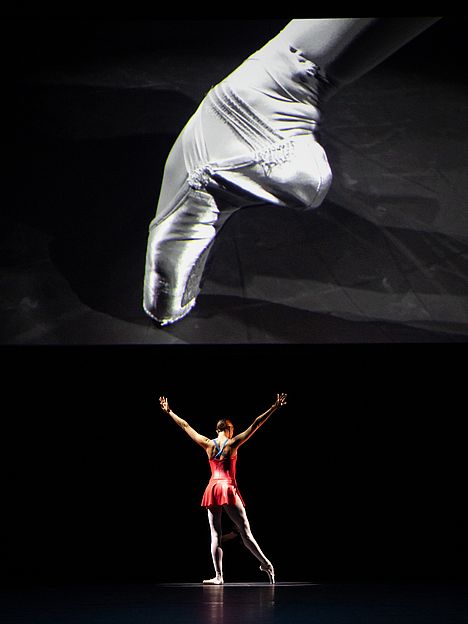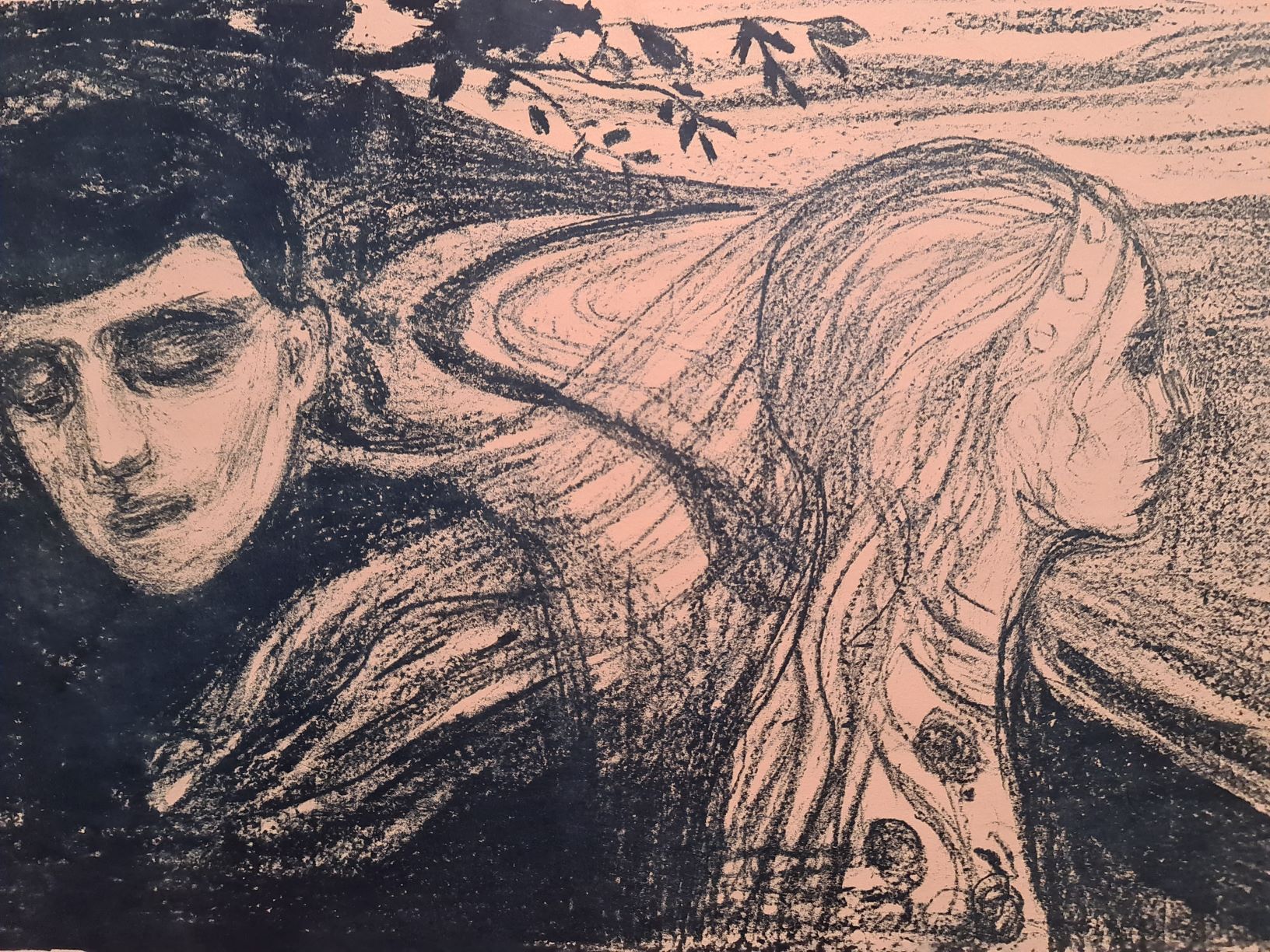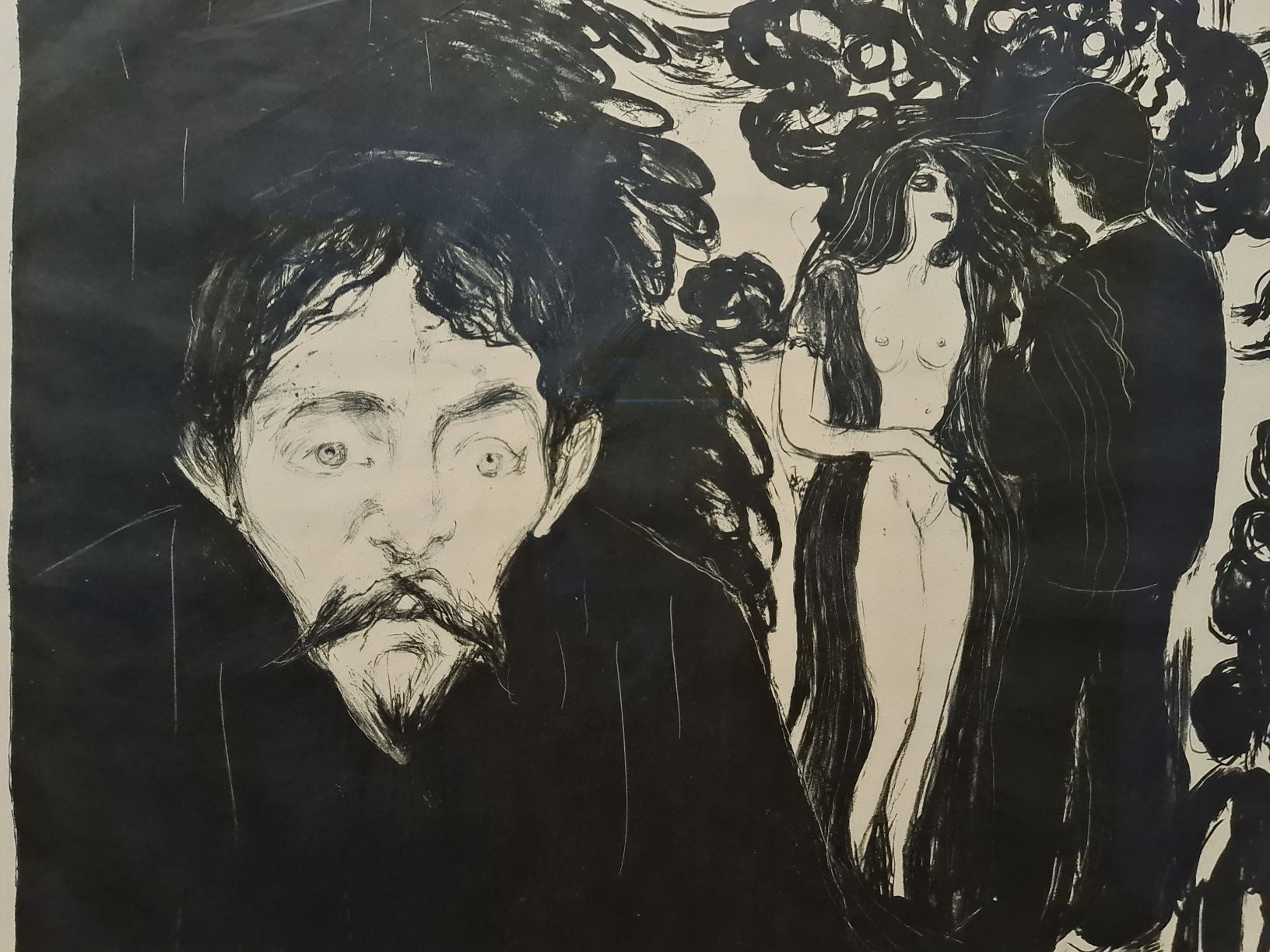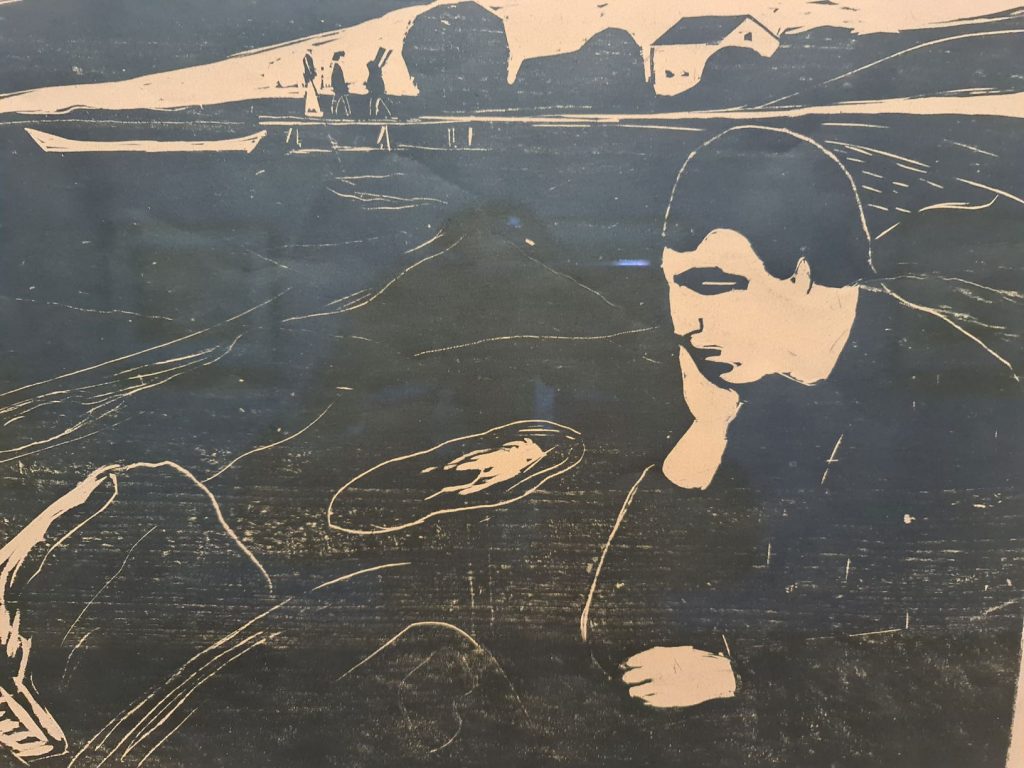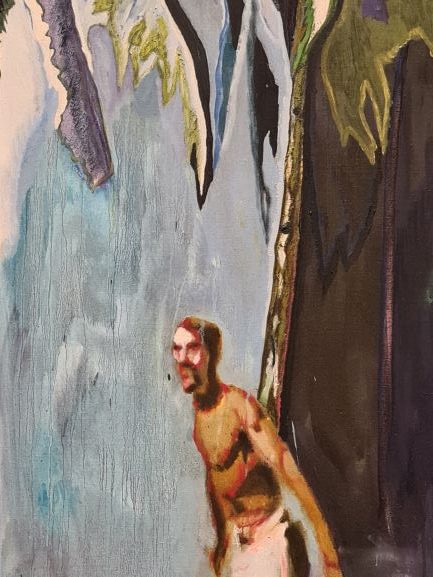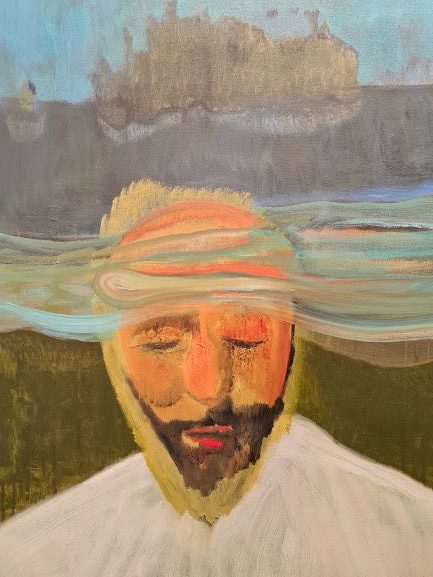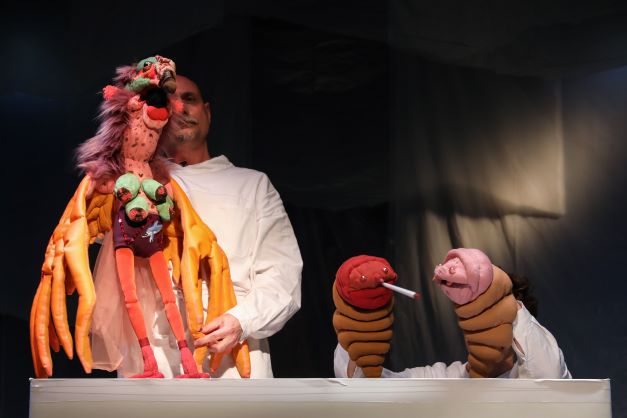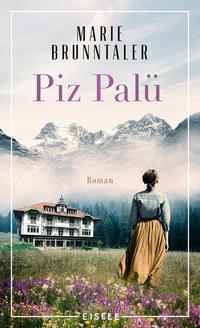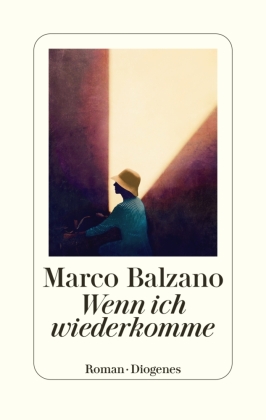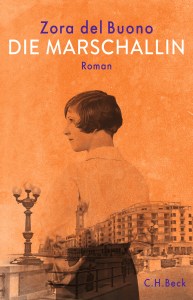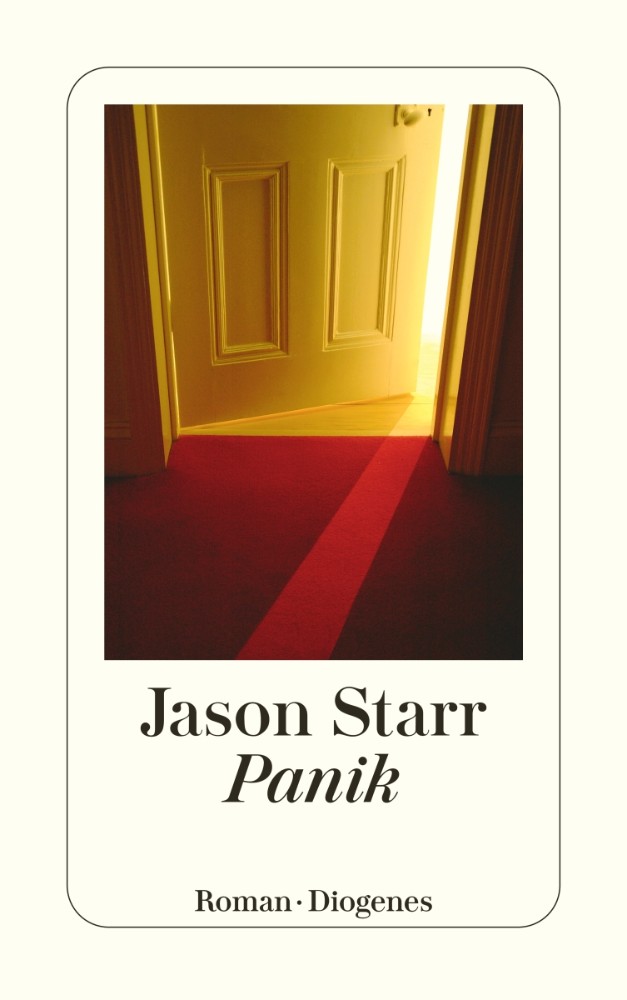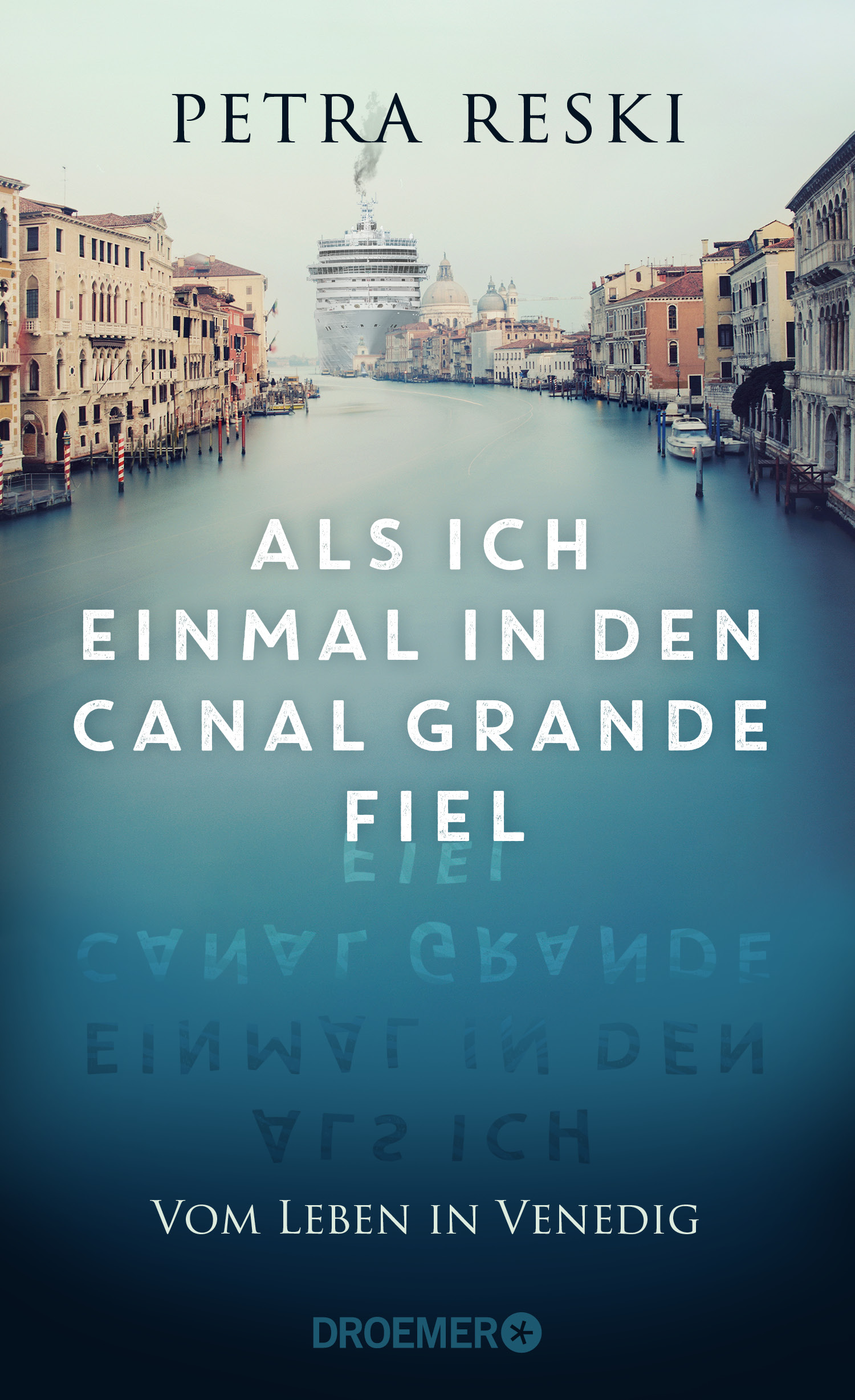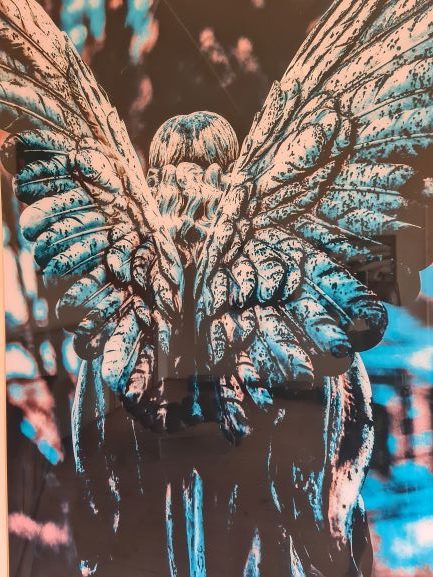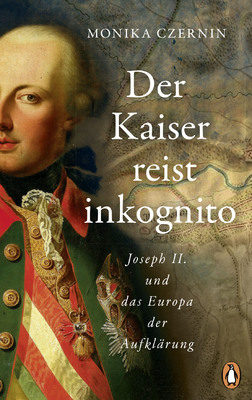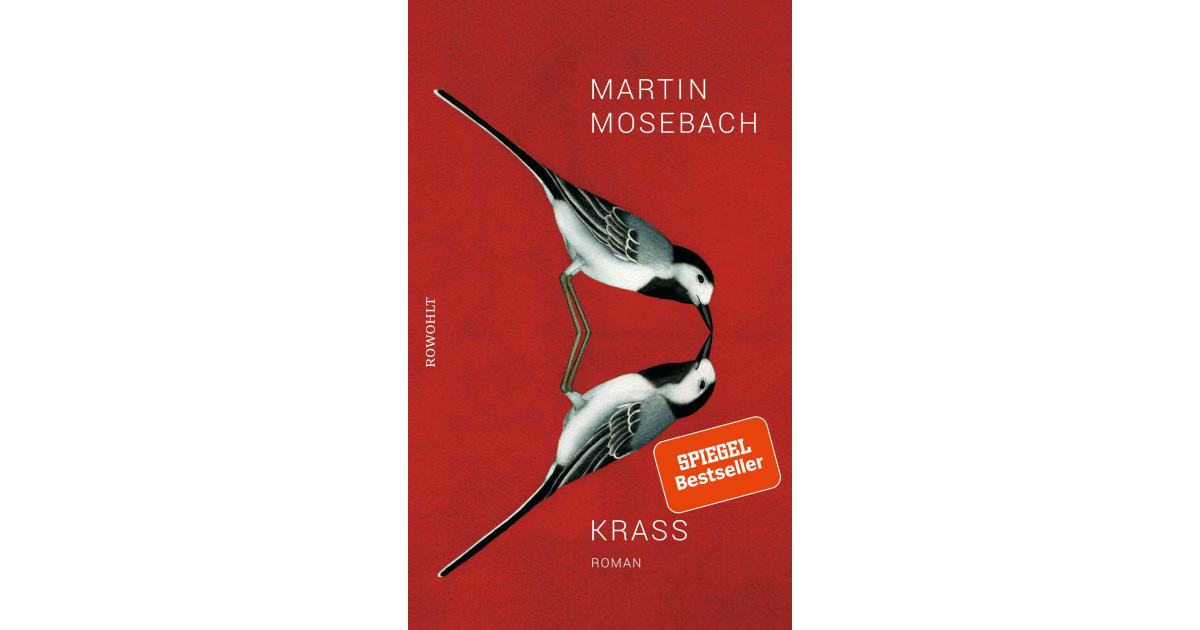Sergej Rachmaninow: Konzert für Klavier und Orchester Nr.3 d-Moll op 30. Klavier: Kyohei Sorita, Dirigent Yutaka Sado
1917 aus Russland in die USA emigriert, fühlte sich Rachmaninow nie wirklich in der neuen Heimat „beheimatet“. Sein Herz und seine Wurzeln blieben russisch. Und seine Musik ebenso. Die Amerikaner sahen in ihm mehr den Tastenvirtuosen als den Komponisten. 1910 wurde das Konzert erstmals in New York aufgeführt und es dirigierte kein Geringerer als Gustav Mahler.
Dieses Klavierkonzert verlangt vom Pianisten all sein Können: Technisch sehr schwierig und thematisch ein WEchselbad der Gefühle – eine muikalische Beschreibung des Komponisten, wie er sich in dem neuen Land fühlte. Kyohei Sorita ist ein technisch perfekter Pianist, sein Spiel ist makellos, seine Läufe beeindruckend. Sein Anschlag hart, exakt, was durch den Steinway noch verstärkt wurde. Und so beeindruckt Sorita mehr durch sein Virtuosentum als durch seine Interpretation. Zwar tönt die Musik eines Zerrissenen laut, heftig und schnell, aber es fehlt ein wenig der Gegenpart: die Zärtlichkeit, die tiefen Gefühle, die Rachmaninow durchaus in das Werk komponierte. Dirigent Yutaka Sado führte das Orchester behutsam und zurückhaltend, ließ die Streicher die Musik wie einen feinen Teppich unter das Klavier legen.
Gustav Mahler: Symphonie Nr. 1 D-Dur inklusive Blumine. Dirigent der Tonkünstler: Yutaka Sado
Nur kurze Zeit nach den wuchtigen Symphonien eines Bruckners und Brahms schrieb Gustav Mahler seine erste Symphonie, in der er alle strenge Logik eines Symphonikers über Bord wirft. 1884 begann er daran zu arbeiten, schrieb immer wieder Neues hinzu – wie die „Blumine“ (eine musikalische Ehrung der Göttin Flora), ließ manches weg. 1889 wurde das Werk in Budapest uraufgeführt. Der damals sehr gefürchtete Kritiker Edward Hanslik schrieb über diese Symphonie: „Das ist keine Musik!“
Gustav Mahler über diese Symphonie: „Sie muss sein wie die Welt, sie muss alles umfassen, auch die weniger schönen Dinge.“ Das gilt wohl für alle Werke Mahlers.
Yutaka Sado schenkte dem Publikum einen Abend, der tief im Gedächtnis bleiben wird. Selten – besser noch nie – hat man diese Symphonie so voller Zartheit, Wildheit, Romantik, Ironie und Versponnenheit gehört. Behutsam beginnen die Streicher, zart, als öffneten sich die Wolken und ein Sonnenstrahl beleuchtet die Erde. Man spürt, wie sehr Orchester und Drigent miteinander verwachsen sind. Sado dirigiert nicht, er schwingt sich in die Melodien ein und mimmt das Orchester mit auf die innere Reise Mahlers. Heiter ist die Luft ringsum, leise erklingt das Lied „Ging heut morgen übers Feld“, ein Thema kollidiert mit dem nächsten, um sich zu einem siegreichen Ende zu arrangieren. In der „Blumine“ lassen Dirigent und Orchester eine Blüte nach der anderen aufblühen. Frühling ist es! Unmittelbar darauf platzt die Energie eines Dorftanzes auf, dann ein Trauermarsch, der in die Träume über einen Lindenbaum hinüberfließt. Um im nächsten Satz das Unwetter über die Welt ziehen zu lassen, Hornisten und Trommler triumphieren, ohne alles zu übertönen. Mit feinem Fingerspitzengefühl lässt der Dirigent die Motive aufsteigen, gibt ihnen Zeit, ohne sie zu zerdehnen. Dem fulminanten Schluss, den die meisten Dirigenten derartig heftig überdrehen, dass nachher die Ohren schmerzen, gibt er den nötigen Wirkungsraum und Stärke, ohne das Tongebilde im puren Lärm und Getöse versinken zu lassen. Auch das für Mahler so typische triumphale Ende bleibt geformt und ausgefeilt.
Das Publikum dankte mit langem Applaus, standing ovation, das Orchester spendete seinem Dirigenten anerkennendem Beifall mit Geigenbogen und Füßen.
Es war eine Sternstunde der Musik!
P.S.: Ein Kompliment an Dr. Alexander Moore, der ein interessante Einführung zu den beiden Werken hielt. Und einmal mehr sei das Programm lobend erwähnt. Die Informationen sind für Laien und Profis gleichermaßen interessant.