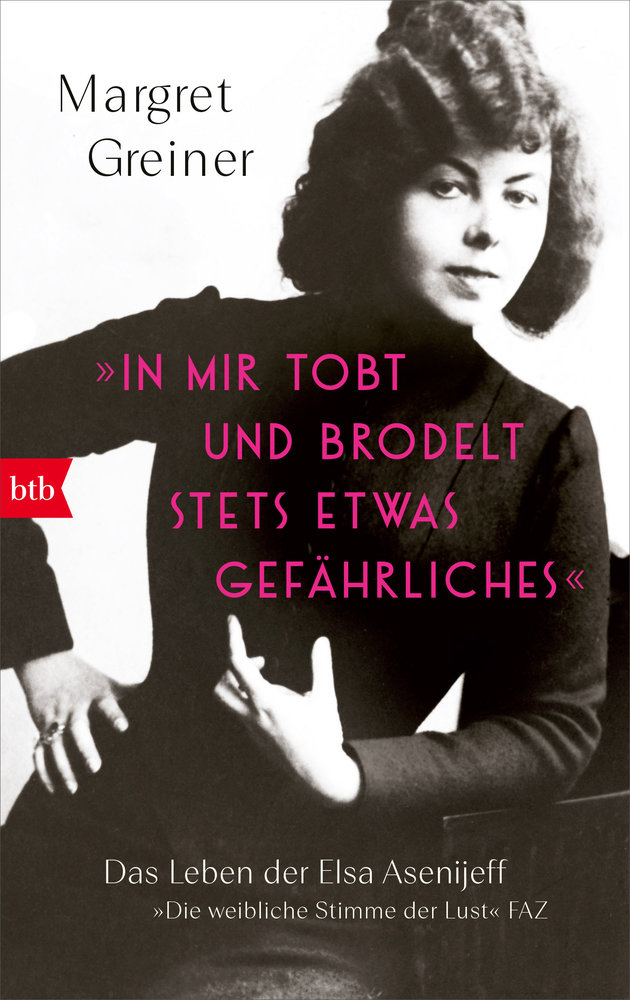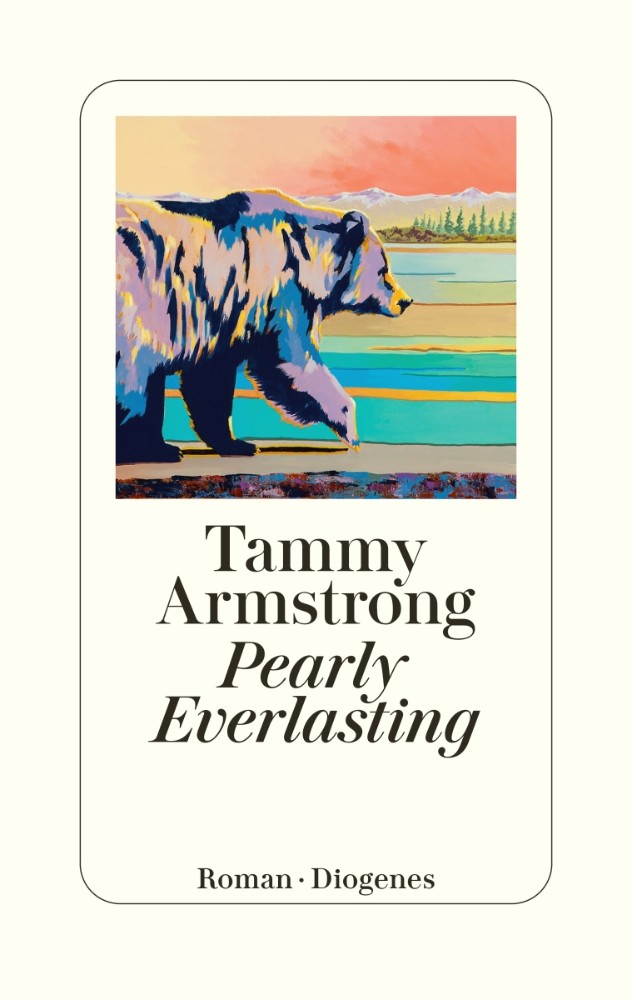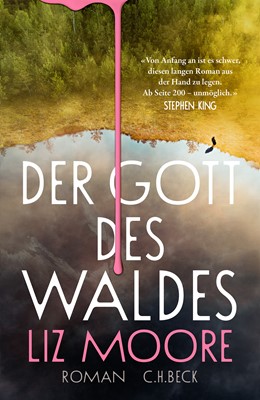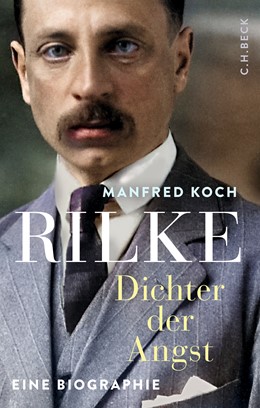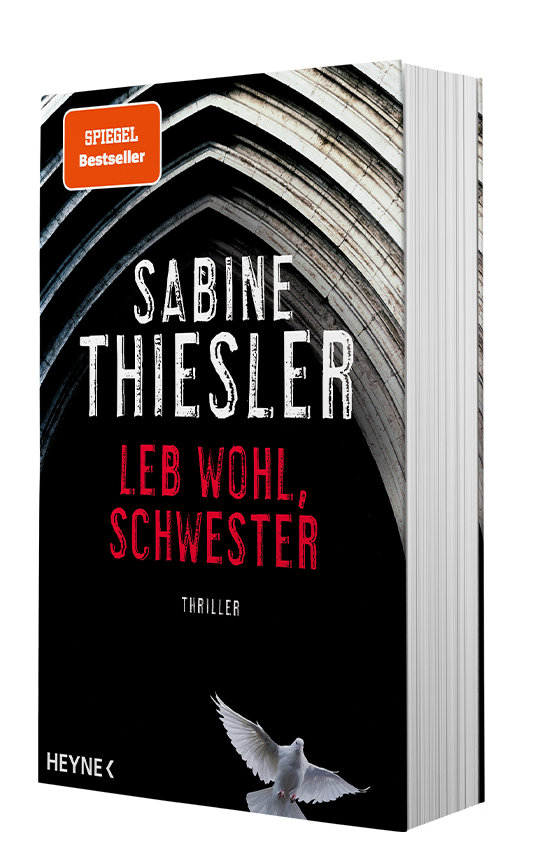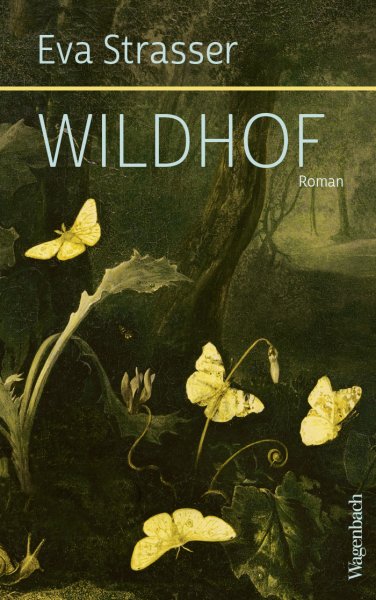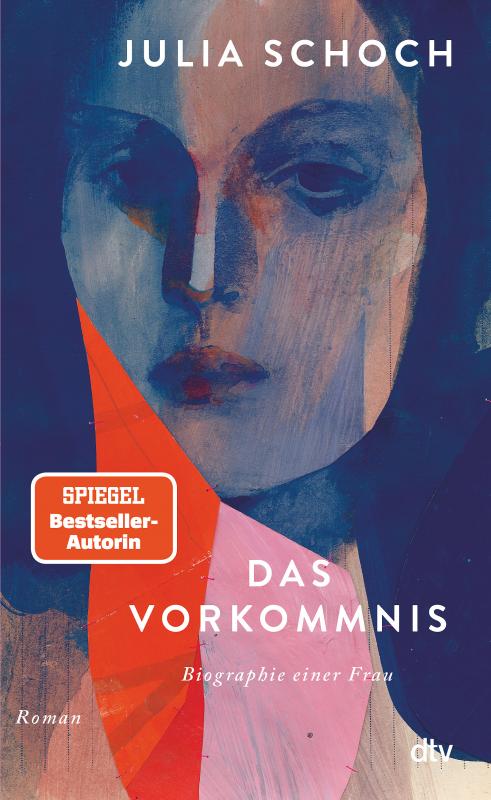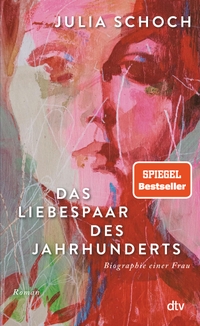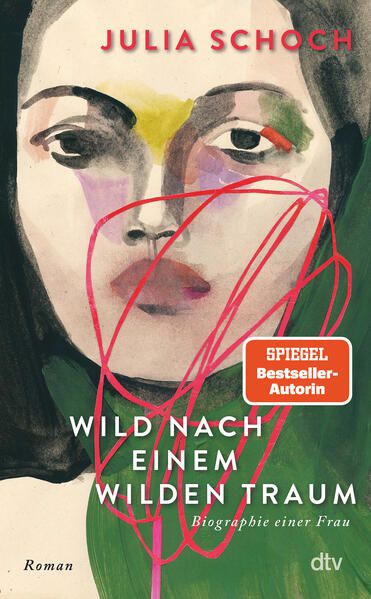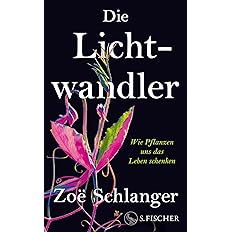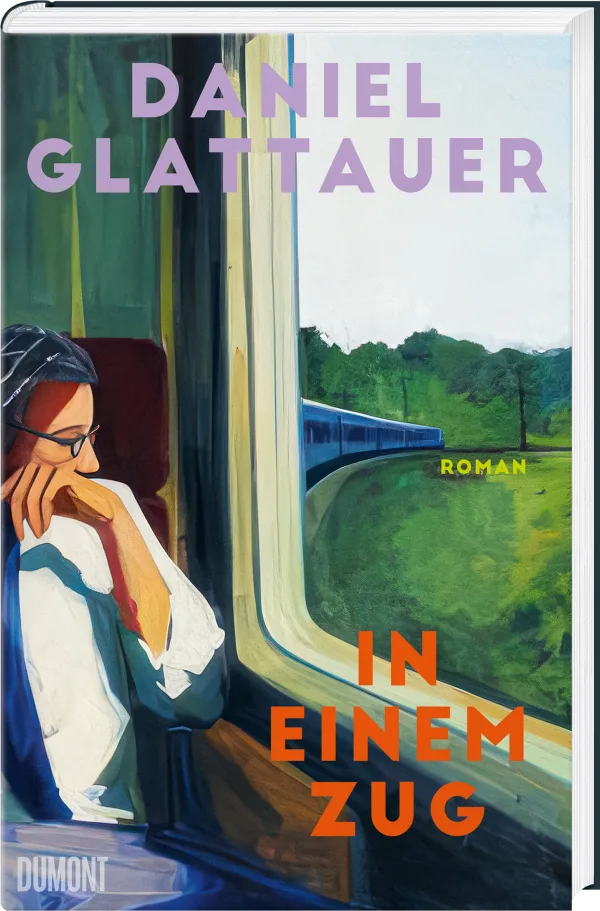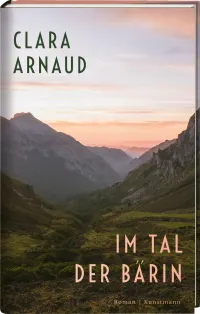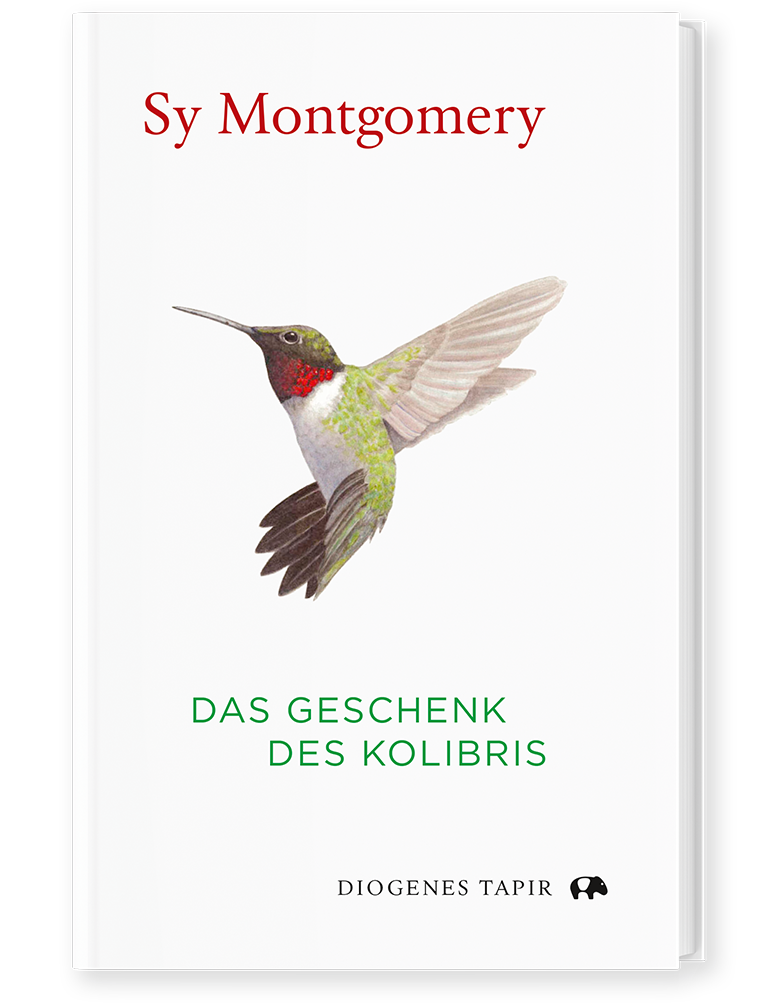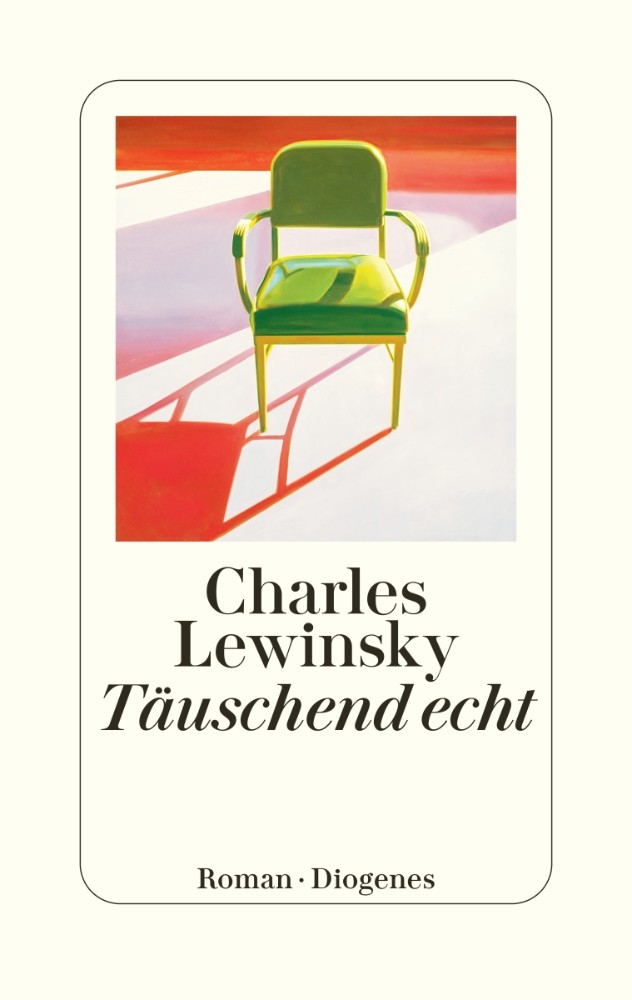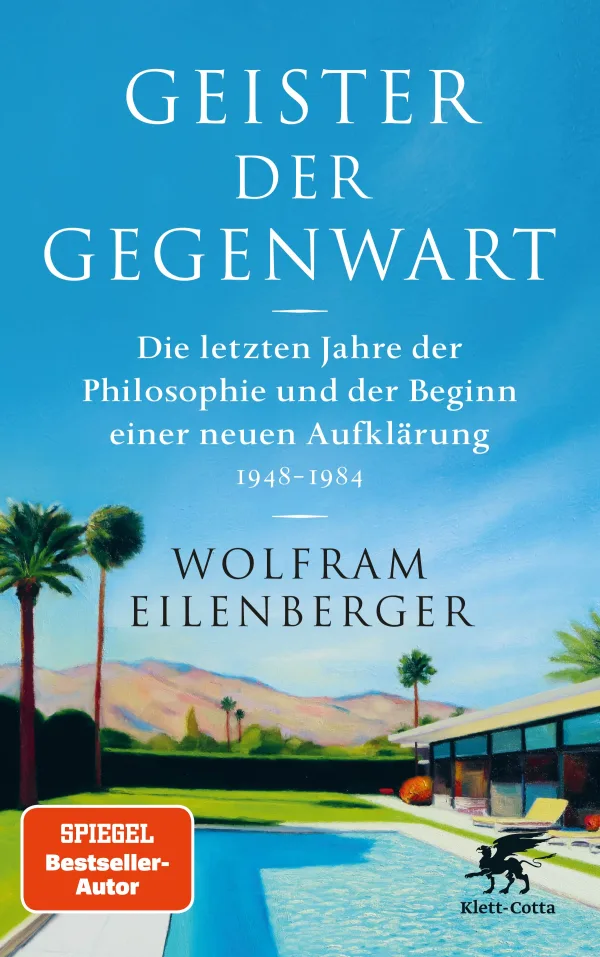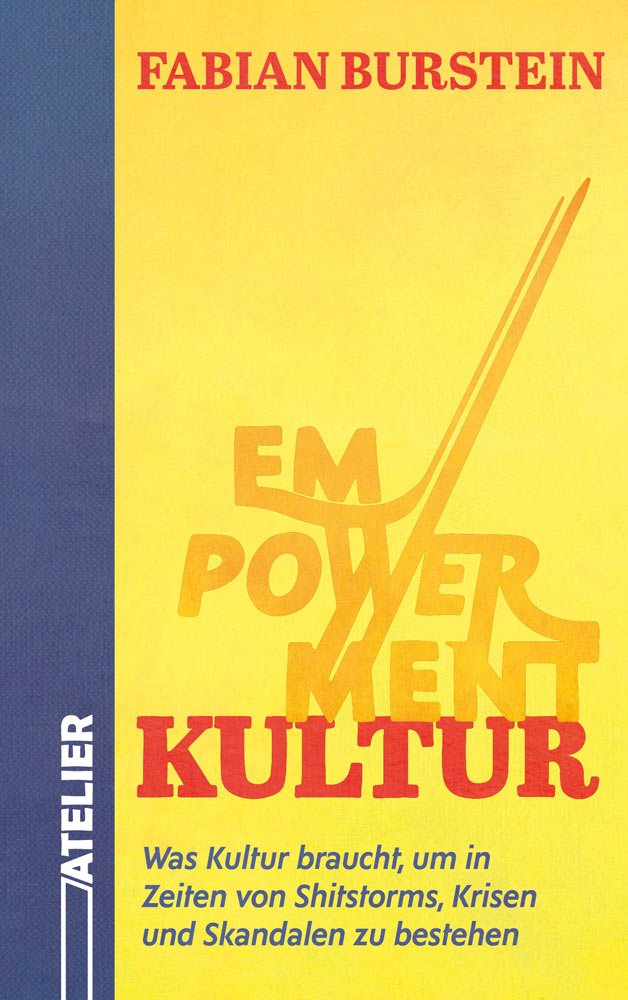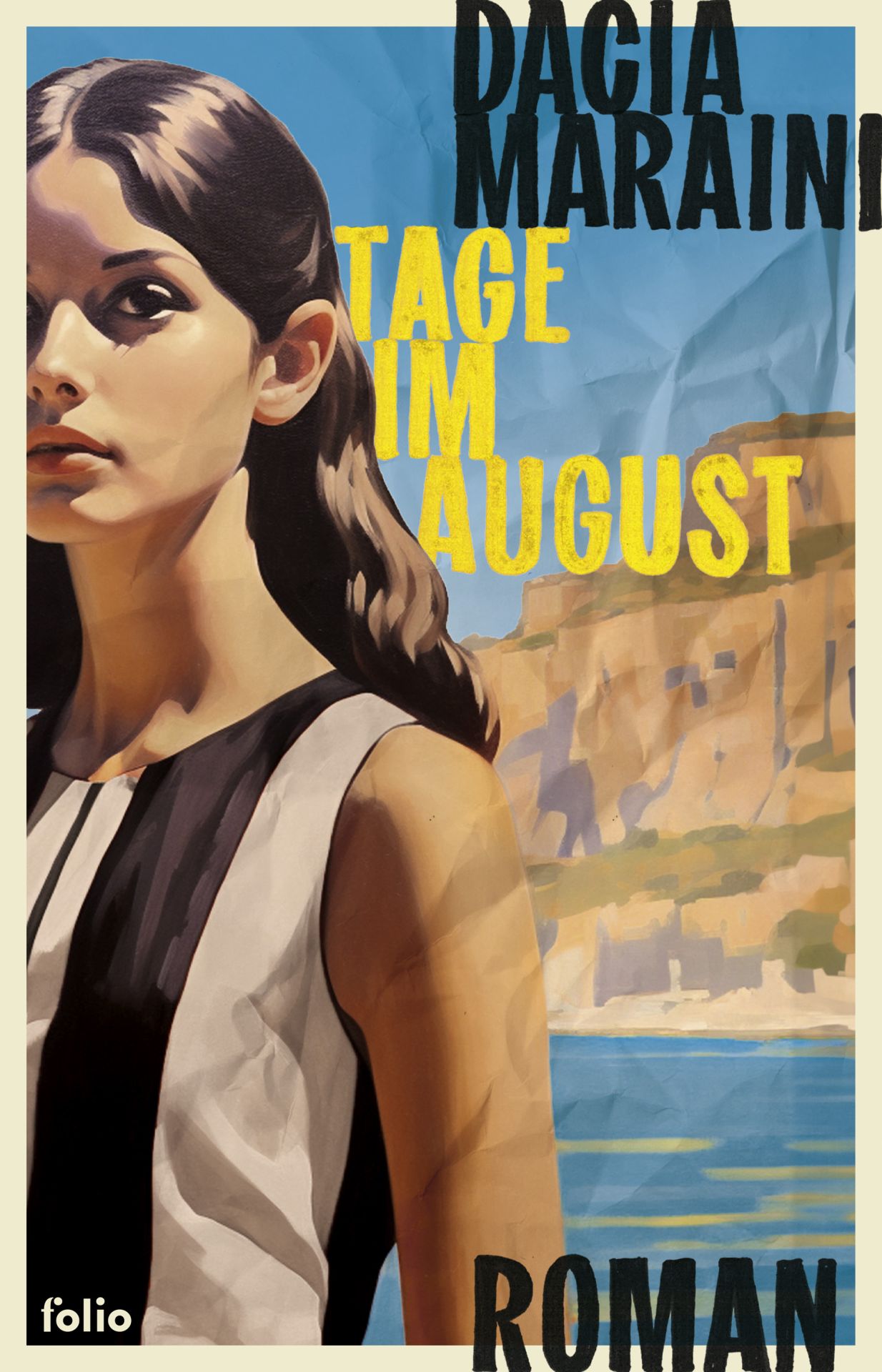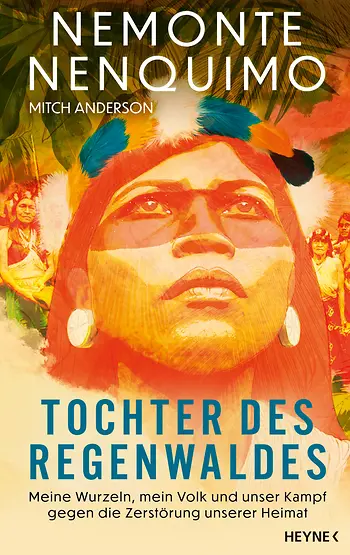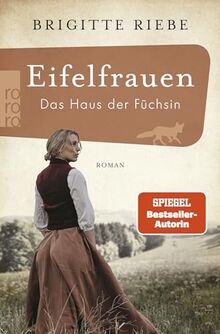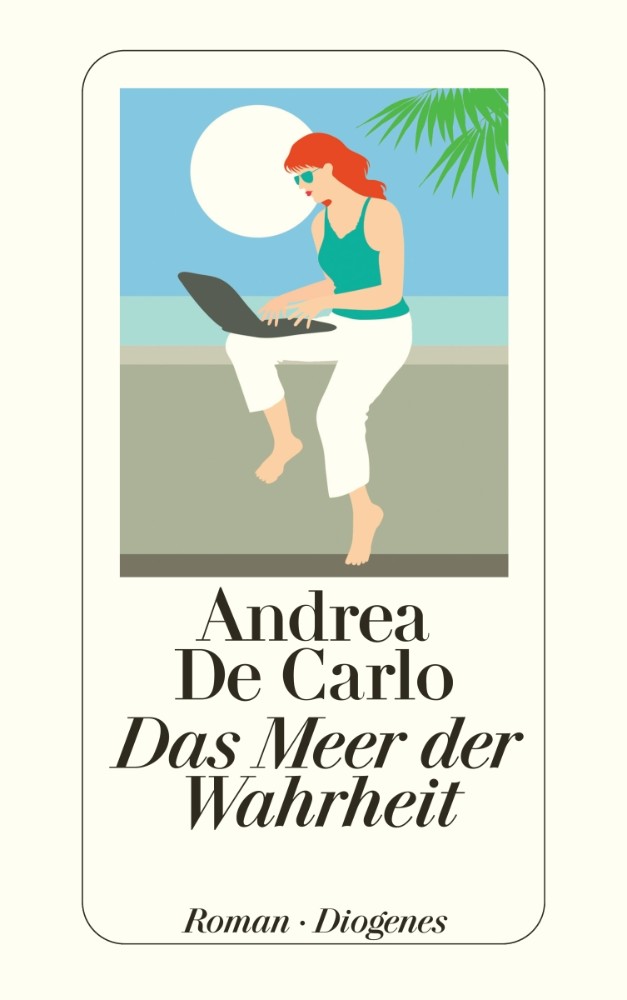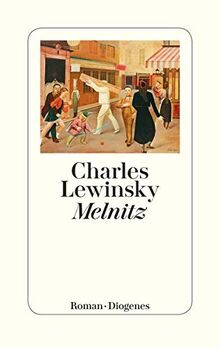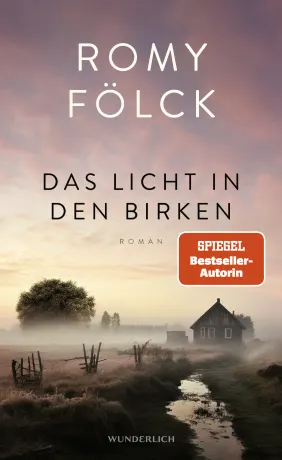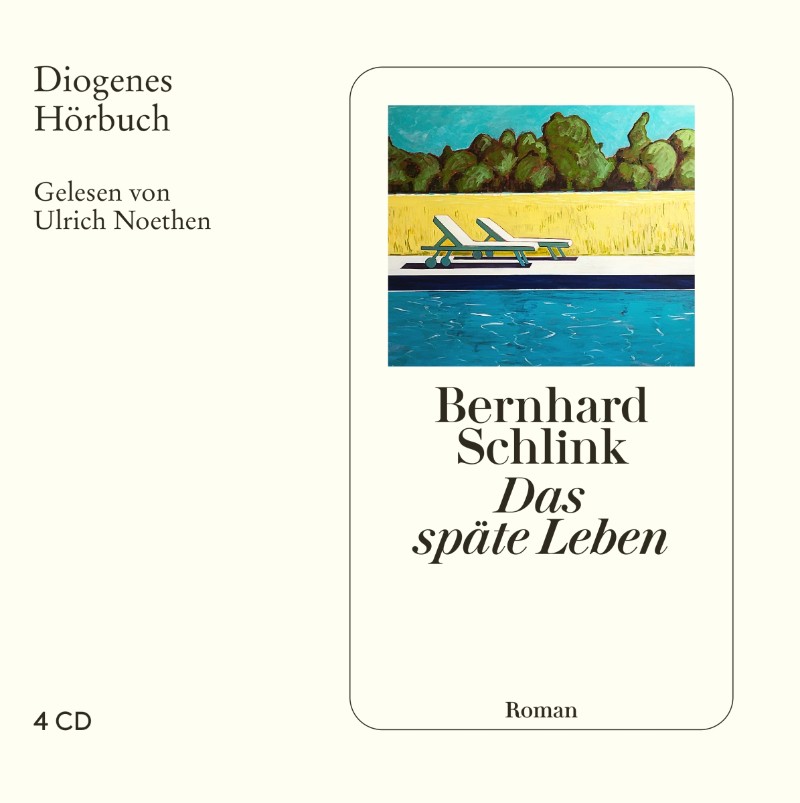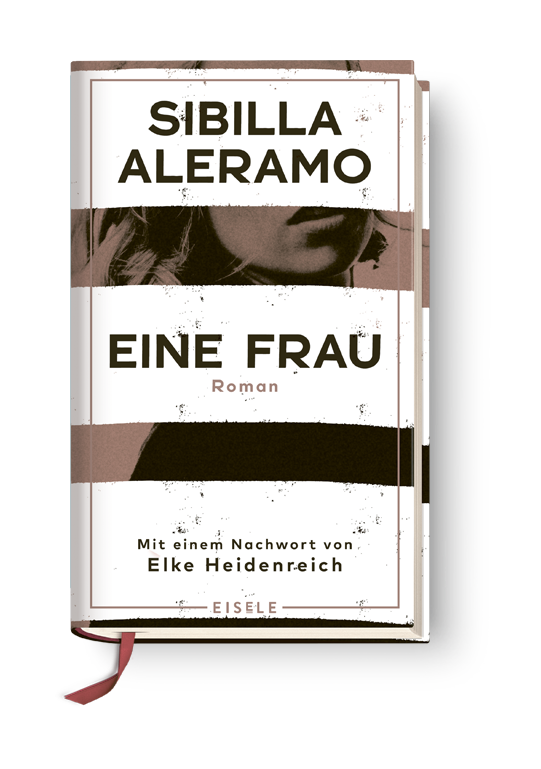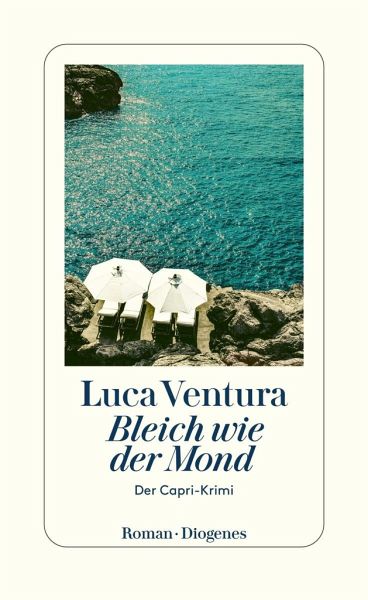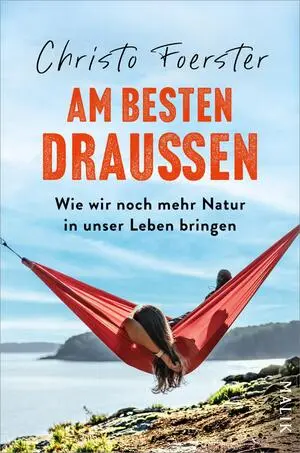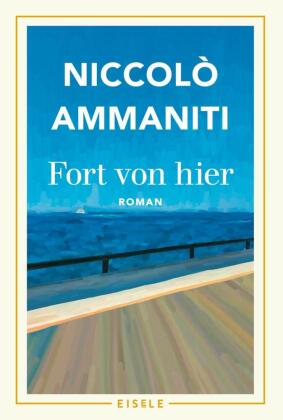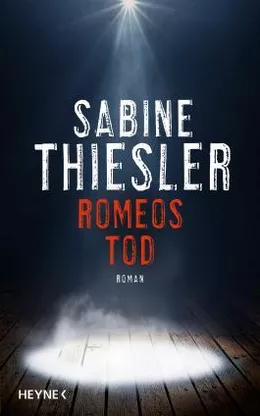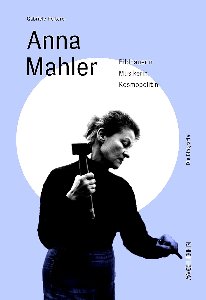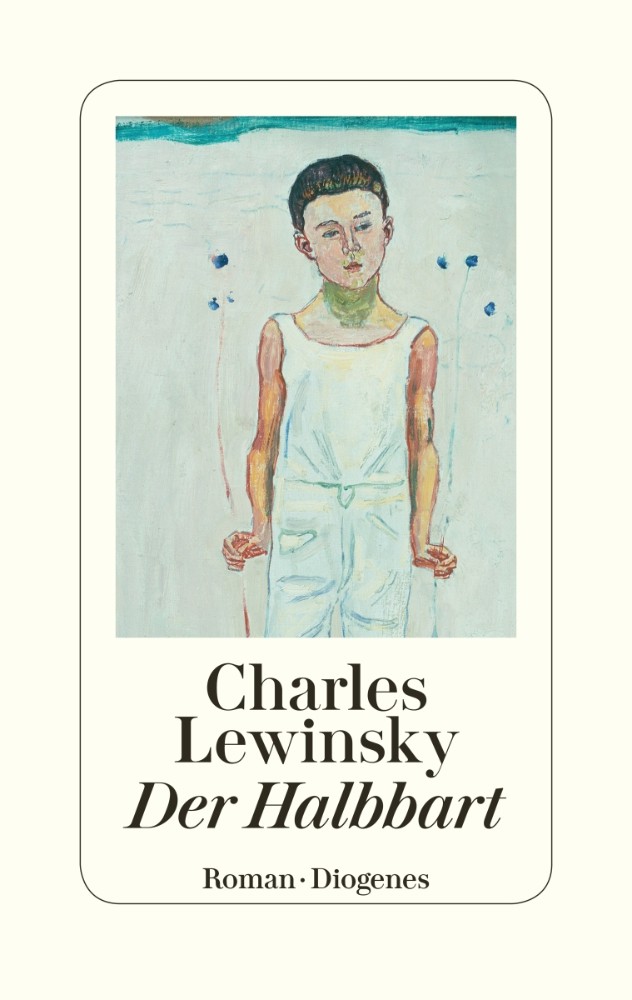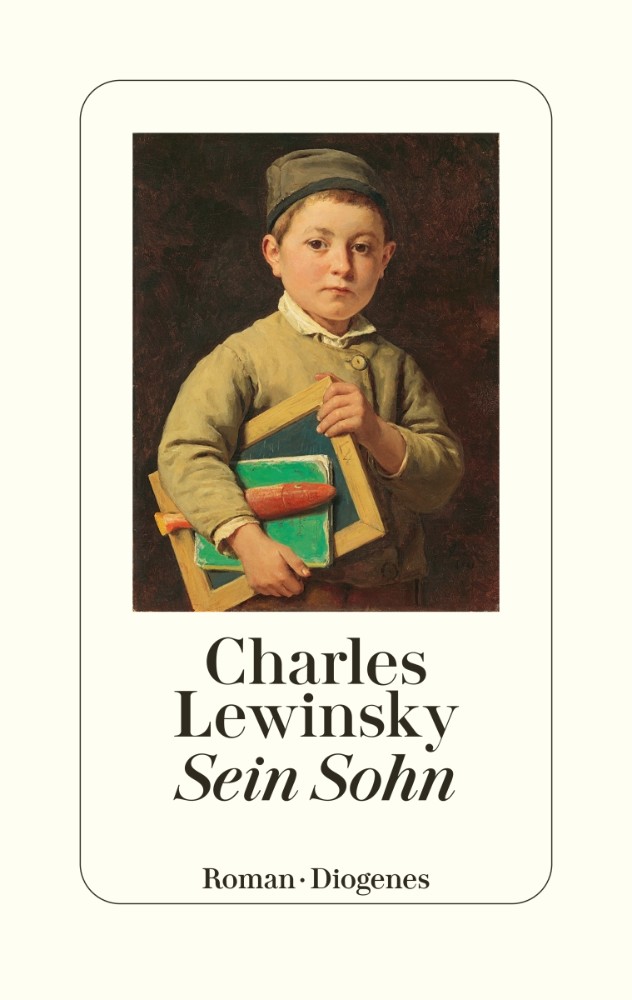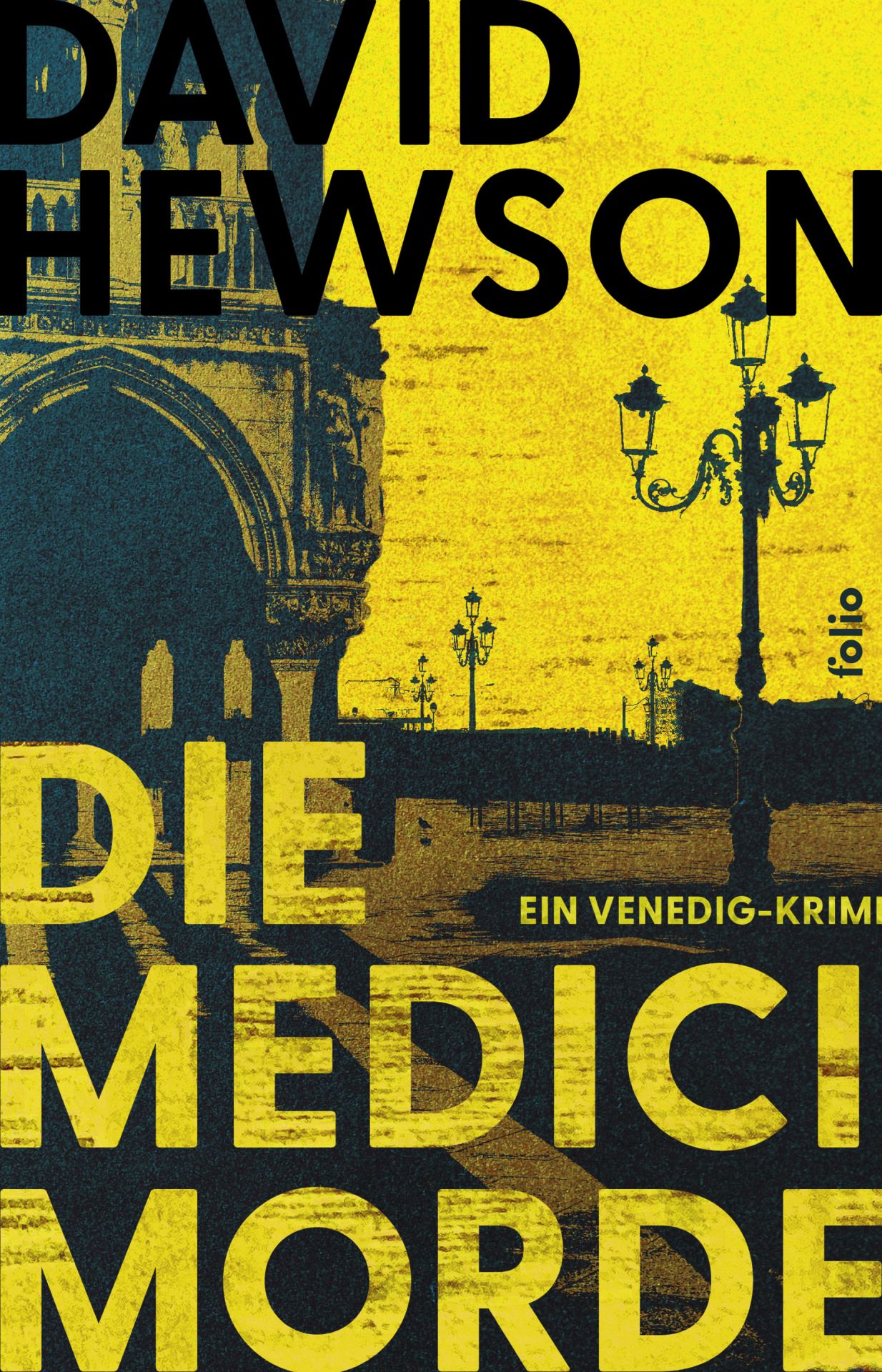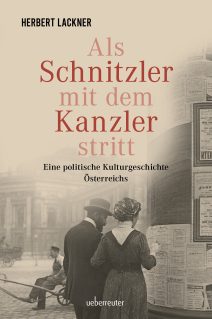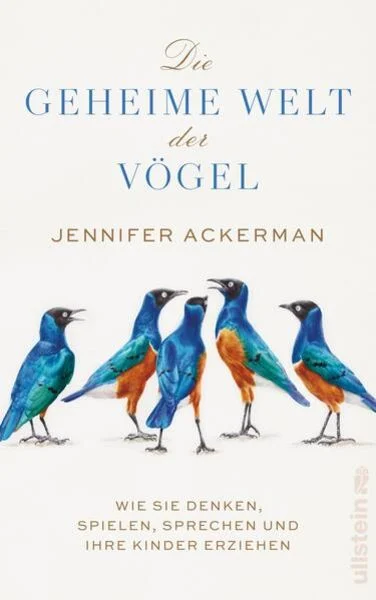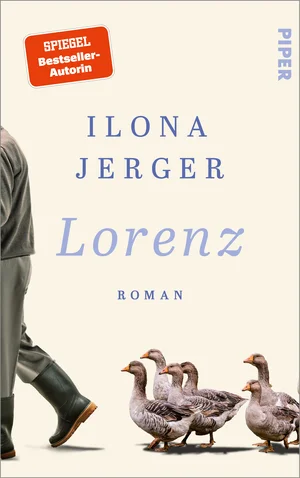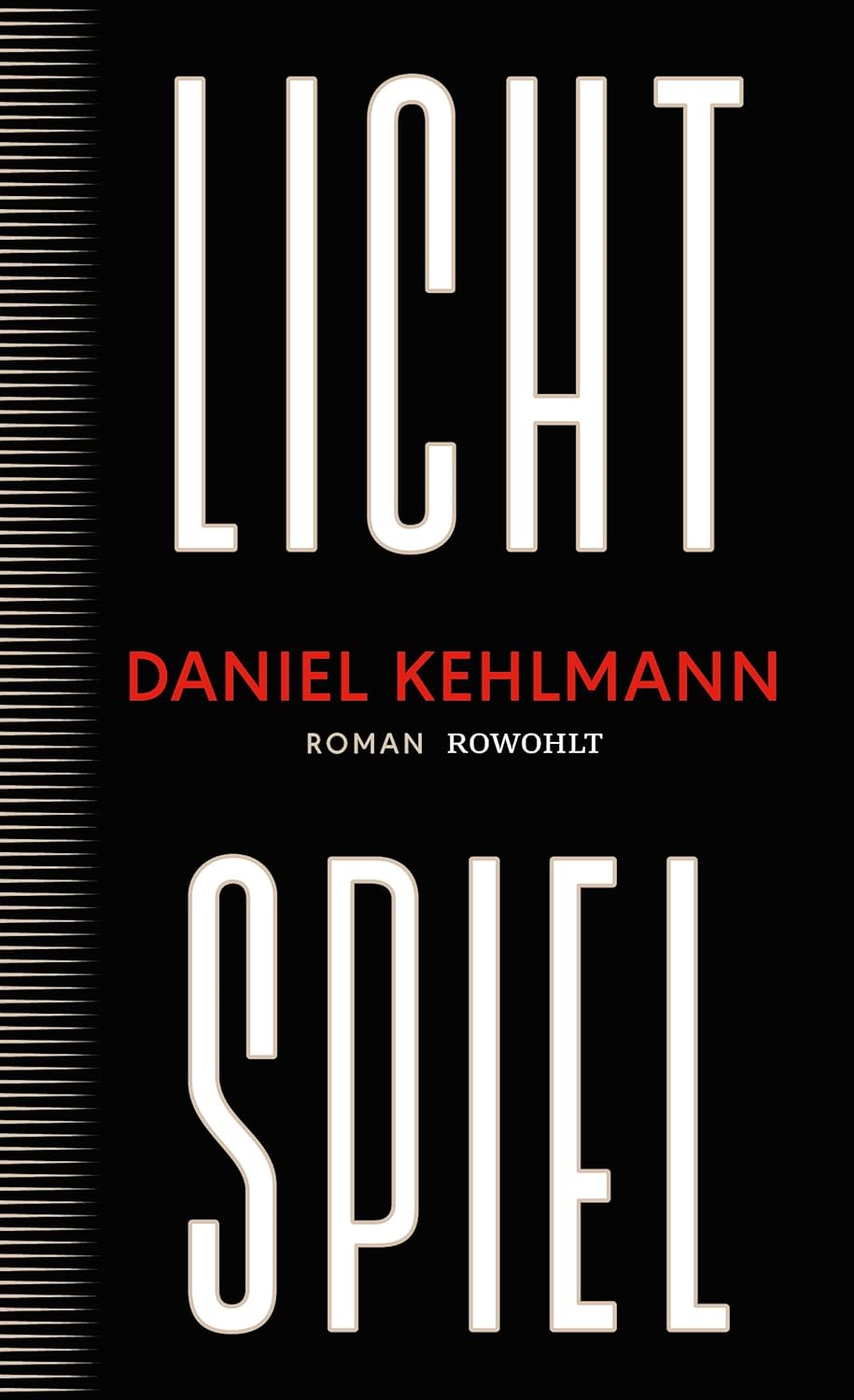Elsa Asenijeff (1867-1941) ist eine in Vergessenheit geratene Schriftstellerin, die sich in der männerdominierten Literatur während der Jahrhundertwende und danach mit starkem Willen und Pathos für die Rechte der Frauen im Allgemeinen, im Speziellen für ein lustbetontes Leben, wie es sich Frauen vorstellen und wünschen, einsetzte. Einst als Grande Dame, Literatin und Lebensgefährtin des Bildhauers Max Klinger in Leipziger Künstlerkreisen und darüber hinaus geschätzt, verehrt – besonders von den Männern – wird sie im Alter verspottet und stirbt völlig vergessen, verarmt in Nervenheilanstalten dahinvegetierend, immer aber hell wach und schreibend bis an ihr trauriges Lebenende.
Margret Greiner gibt dieser Kämpferin die ihr gebührende Aufmerksamkeit zurück. Ob sie ihr auch den Platz in der Literatur durch dieses Buch wird sichern können, ist fraglich. Denn Elsa Asenijeffs Sprache ist pathosprall, oft auch schwülstig, und ihre alle Männer umfassende Verachtung – zumindest bis sie Max Klinger kennen lernt – ist nicht immer nachvollziehbar. Sie mochte nicht unter der finanziellen und gesellschaftlichen „Fuchtl“ ihres im Grunde sehr toleranten Ehemanns leben. Sie wollte studieren. Und so siedelt sie von dem Ehenest in Sofia nach Leipzig in die Freiheit, wie sie immer wieder jubelnd schreibt. Obwohl um die Jahrhundertwende Frauen an der Uni nur als Gasthörerinnen gestattet waren, gelingt es ihr bald, durch ihre Intelligenz, Diskussionsfreude und letztlich auch durch ihre aufmüpfigen Schriften die Aufmerksamkeit der Intelligenzia von Leipzig zu erregen. Ihre fast orientalisch antmutende Schönheit (das Titelbild wird ihr offensichtlich nicht gerecht, im Bandinneren gibt es leider keine Fotos) erregt Aufsehen und zugleich Unmut bei den bürgerlichen Schichten. Doch unbeirrt schreibt sie, veröffentlicht und hält Lesungen vor einem begeisterten Publikum. Ihre Geschichten und Gedichte drehen sich immer um Frauen, die in Unterwerfung leben, aber von einem Leben in Unabhängigkeit träumen. Ihre Forderung, Frauen sollten gänzlich die Sexualität ablehnen, ist mehr eine Kampfparole als gelebte Wirklichkeit. Denn kaum kommt der reiche Traumprinz in Person des damals berühmten und gut verdienenden Bildhauers Max Klinger, wirft sie all ihre Vorsätze über Bord. Die beiden werden über 15 Jahre lang ein Paar, das Traumpaar in der Leipziger Künstlerriege. Und nicht nur dort. Klingers Ruf reicht bis Frankreich und Italien. Sie wird sein Modell, seine Muse, seine Trösterin in depressiven Tagen, seine Kritikerin, nie aber seine Ehefrau. Der Traum hat nur einen Widerhaken: Sie ist finanziell von ihm abhängig und wirft sein Geld, das er ihr reichlich gibt, für unnötigen Luxus hinaus. Als sie von ihm ein Kind bekommt, ist er nicht bereit für die Ehe. Sie überlässt das Mädchen einer Französin und lebt ihr Leben mit dem Strahlemann Klinger als Strahlefrau weiter. Bis eines Tages eine ganz Junge ihr den Platz an Klingers Seite streitig macht. Der Geldstrom wird abgedreht, Krieg und Not sind ihre Begleiter. Die Schönheit vergeht, sie wird delogiert, ihre Habe gepfändet. Aber selbst in der Nervenheilanstalt gibt sie nicht auf, schreibt gegen den aufkommenden zweiten Weltkrieg an, warnt unermüdlich. Ihr einsamer Tod berührt sehr.
Als Leserin ist es nicht immer leicht gewesen, diese Frau in ihrer exaltierten Sprache und ihrem theatralischen Auftreten zu lieben. Erst als sie in Not lebt, kämpft und kämpft, wird sie zu „der Elsa Asenijeff“: Kraftvoll, wenn auch oft kraftlos, mutig, wenn auch oft mutlos, in der Sprache präziser, härter, treffender. Pathos und Kitsch fallen ab.