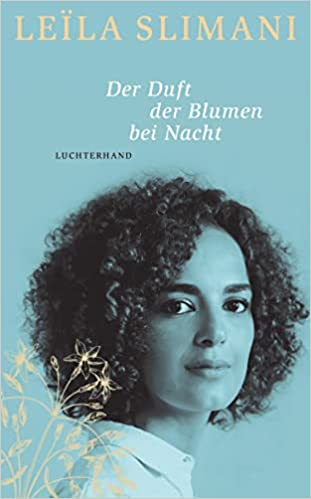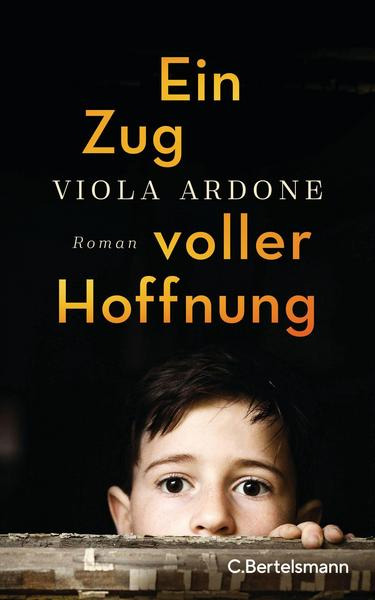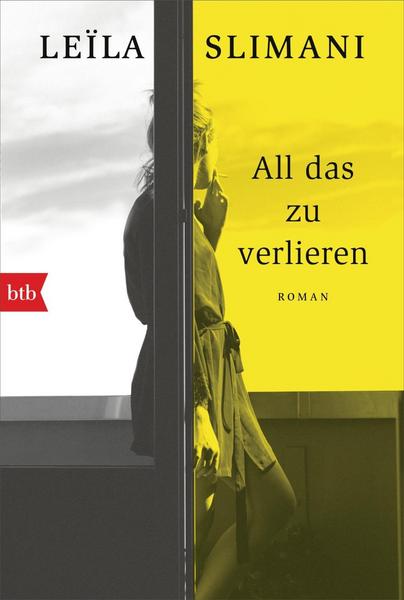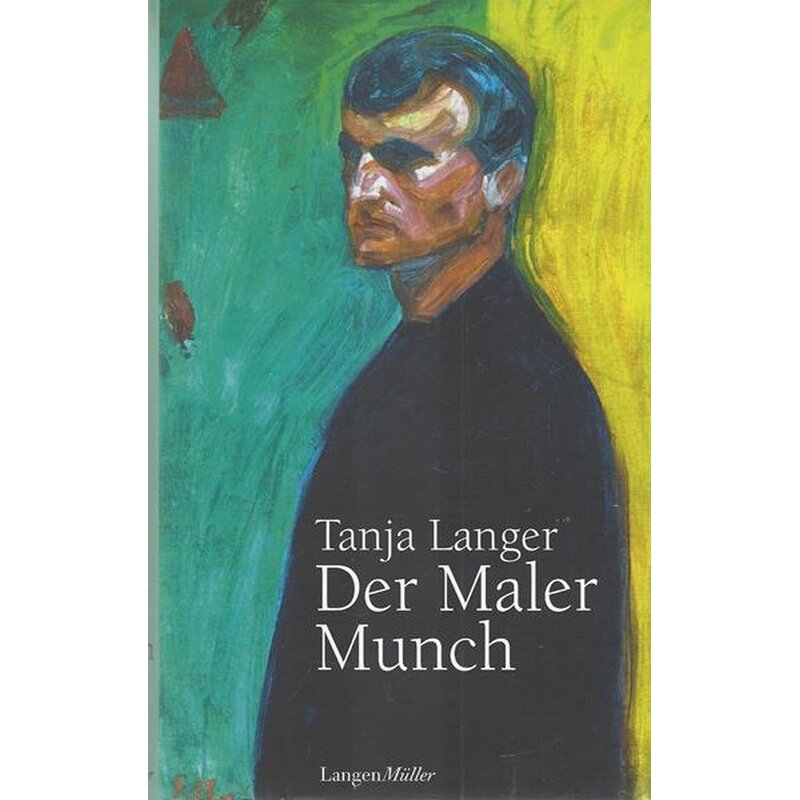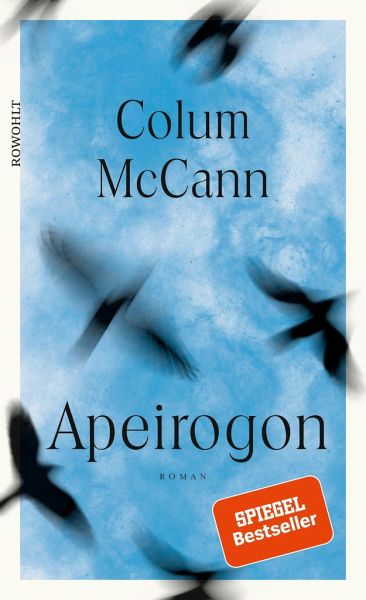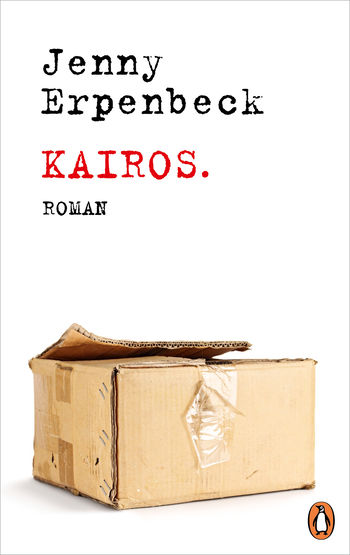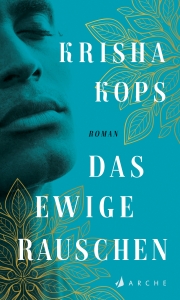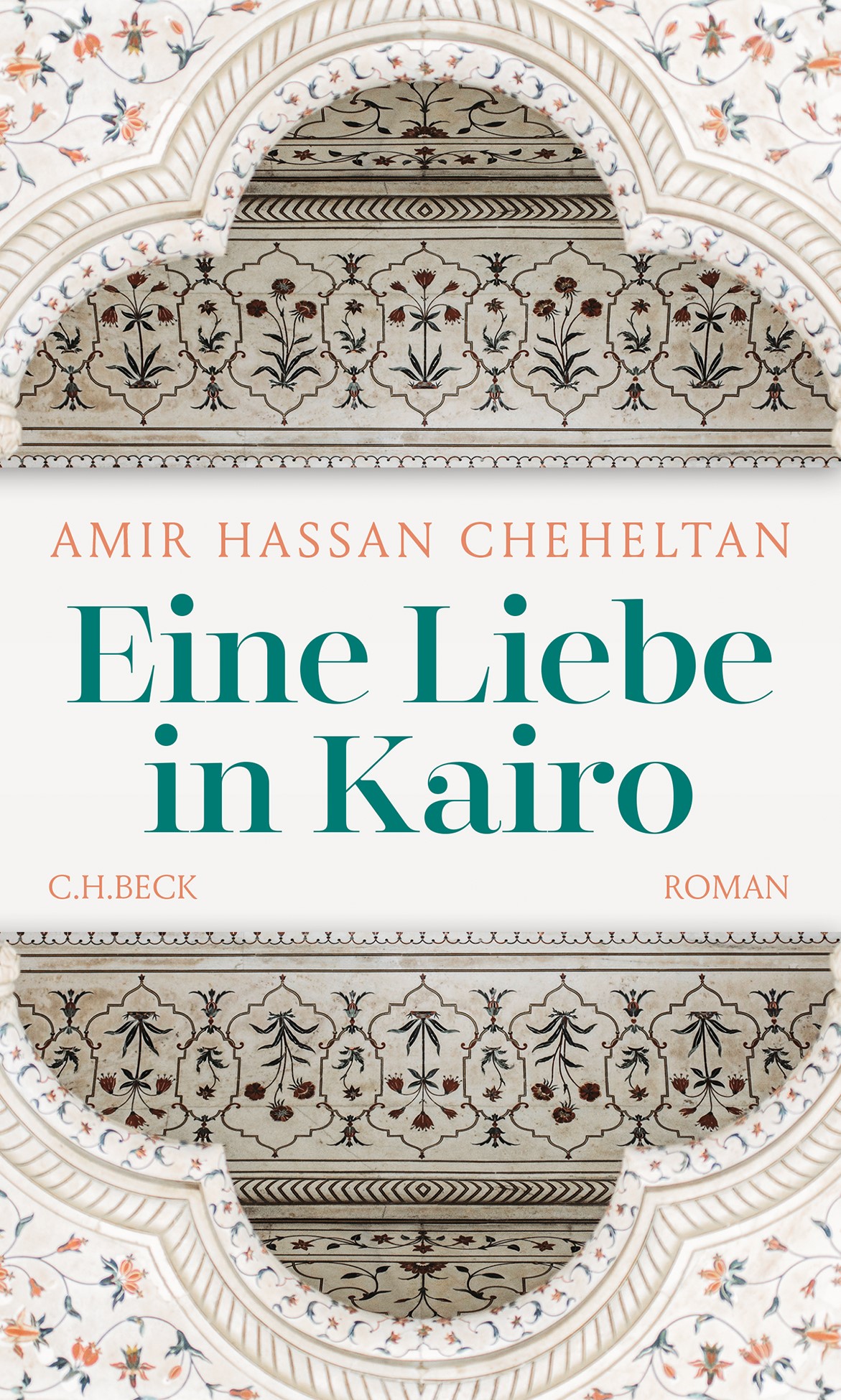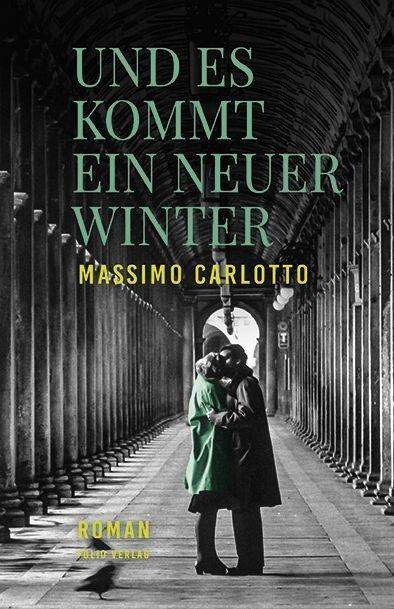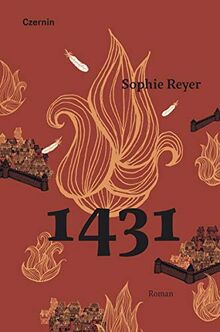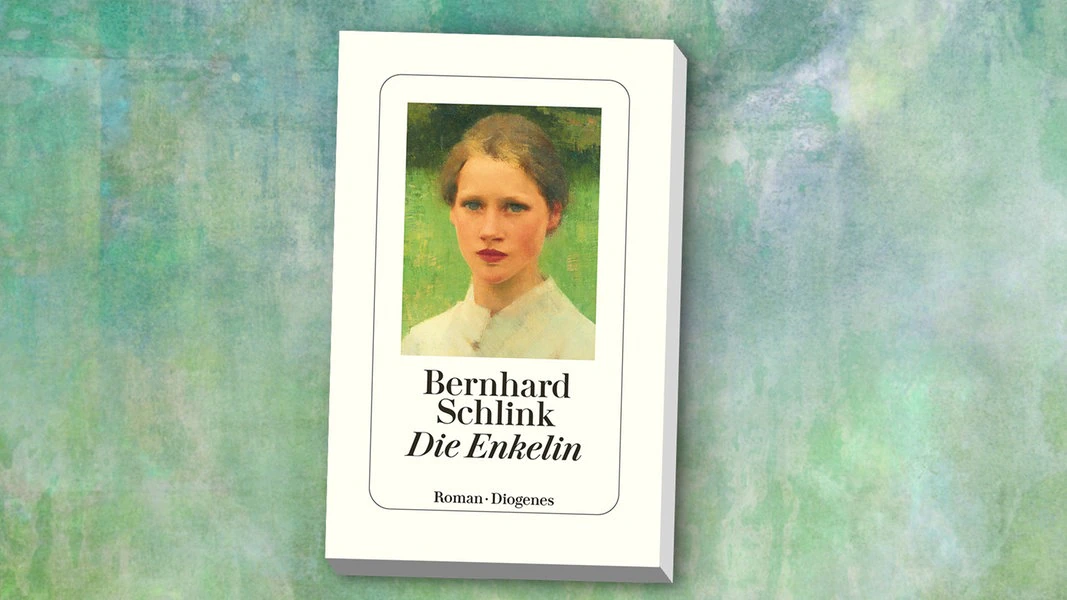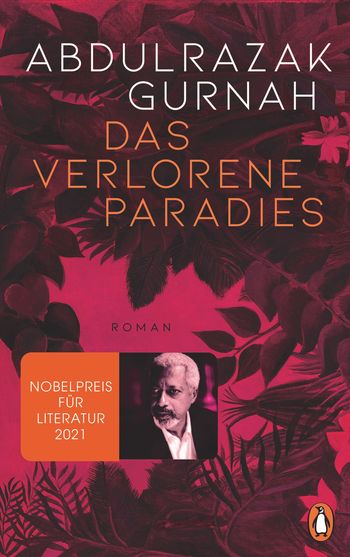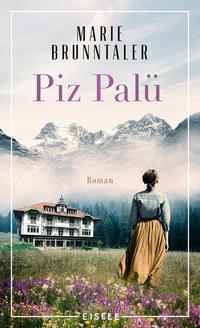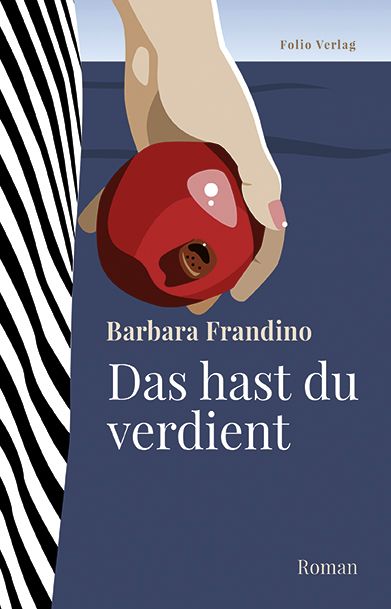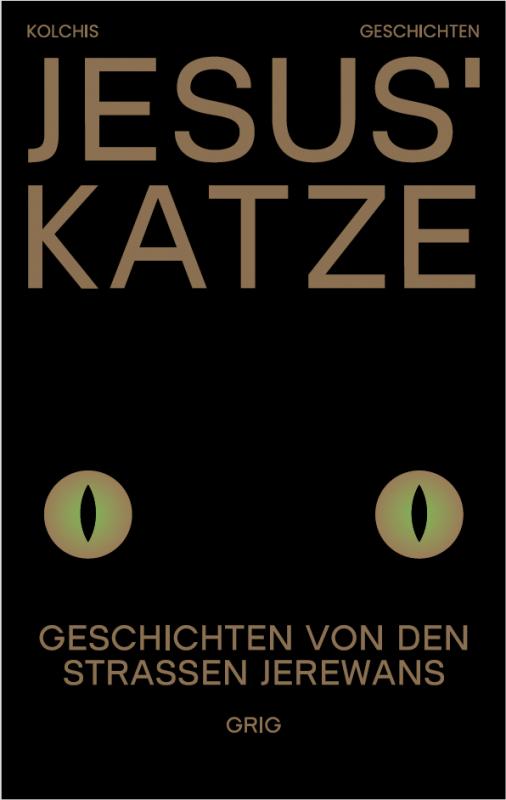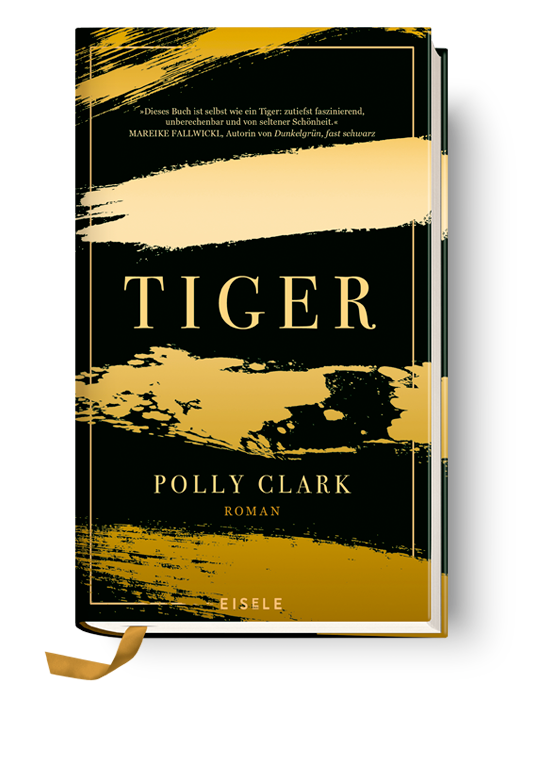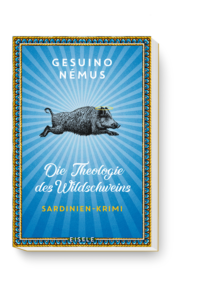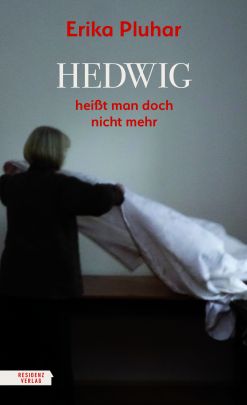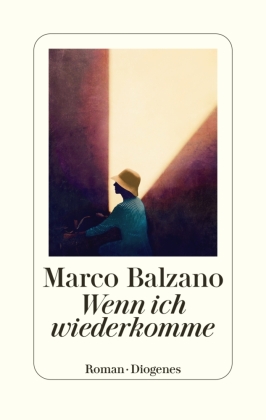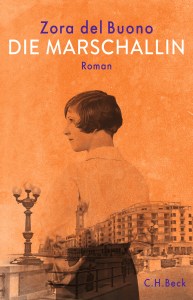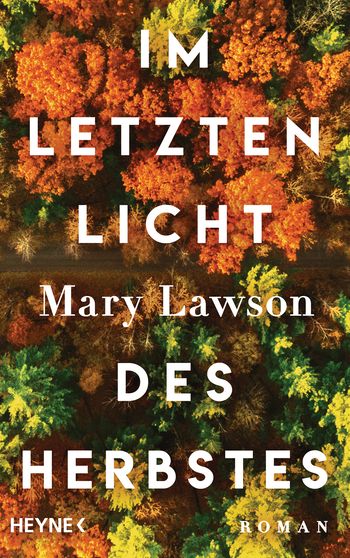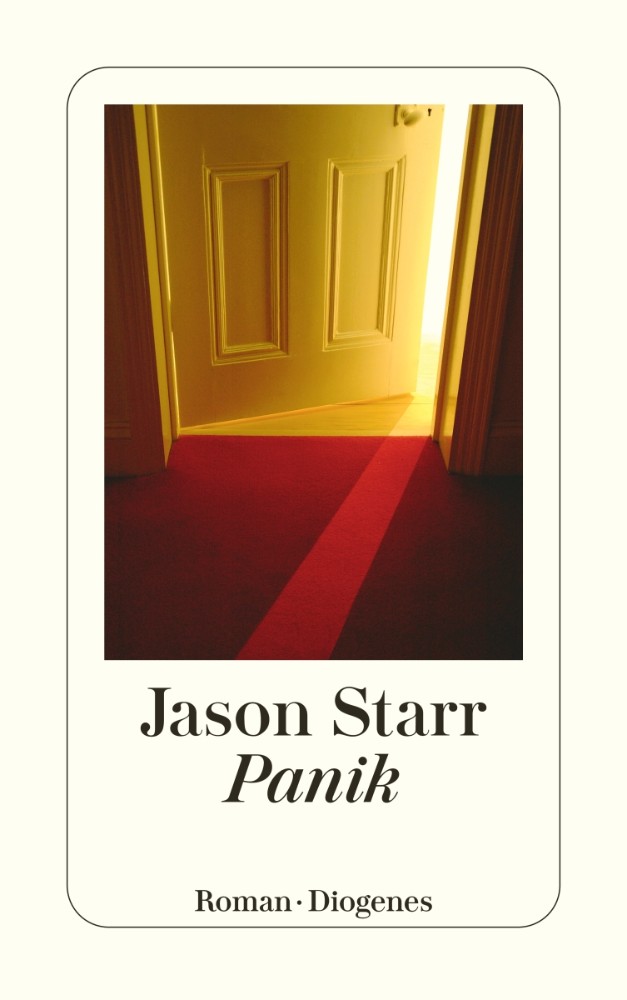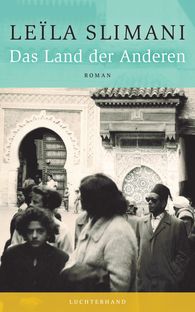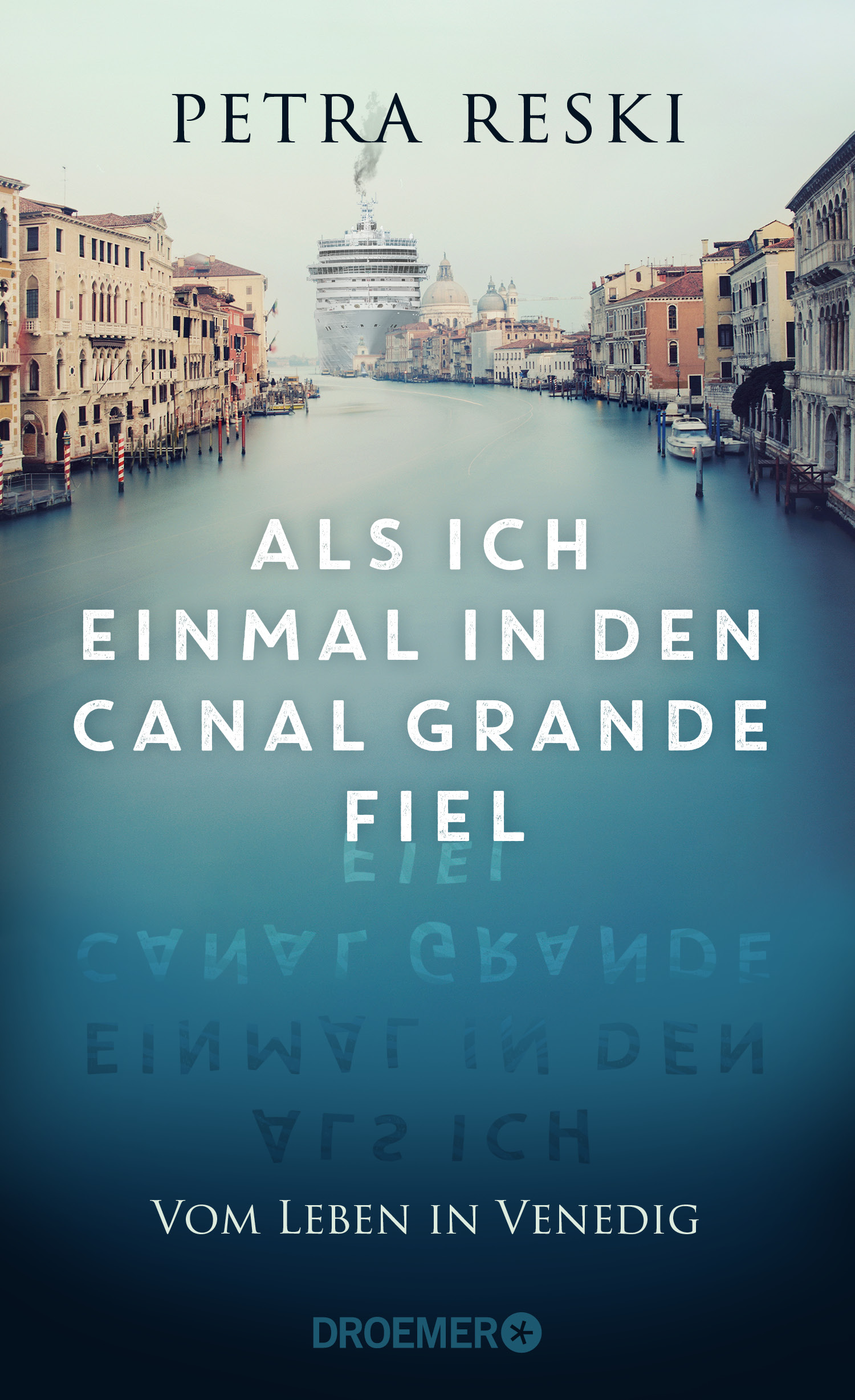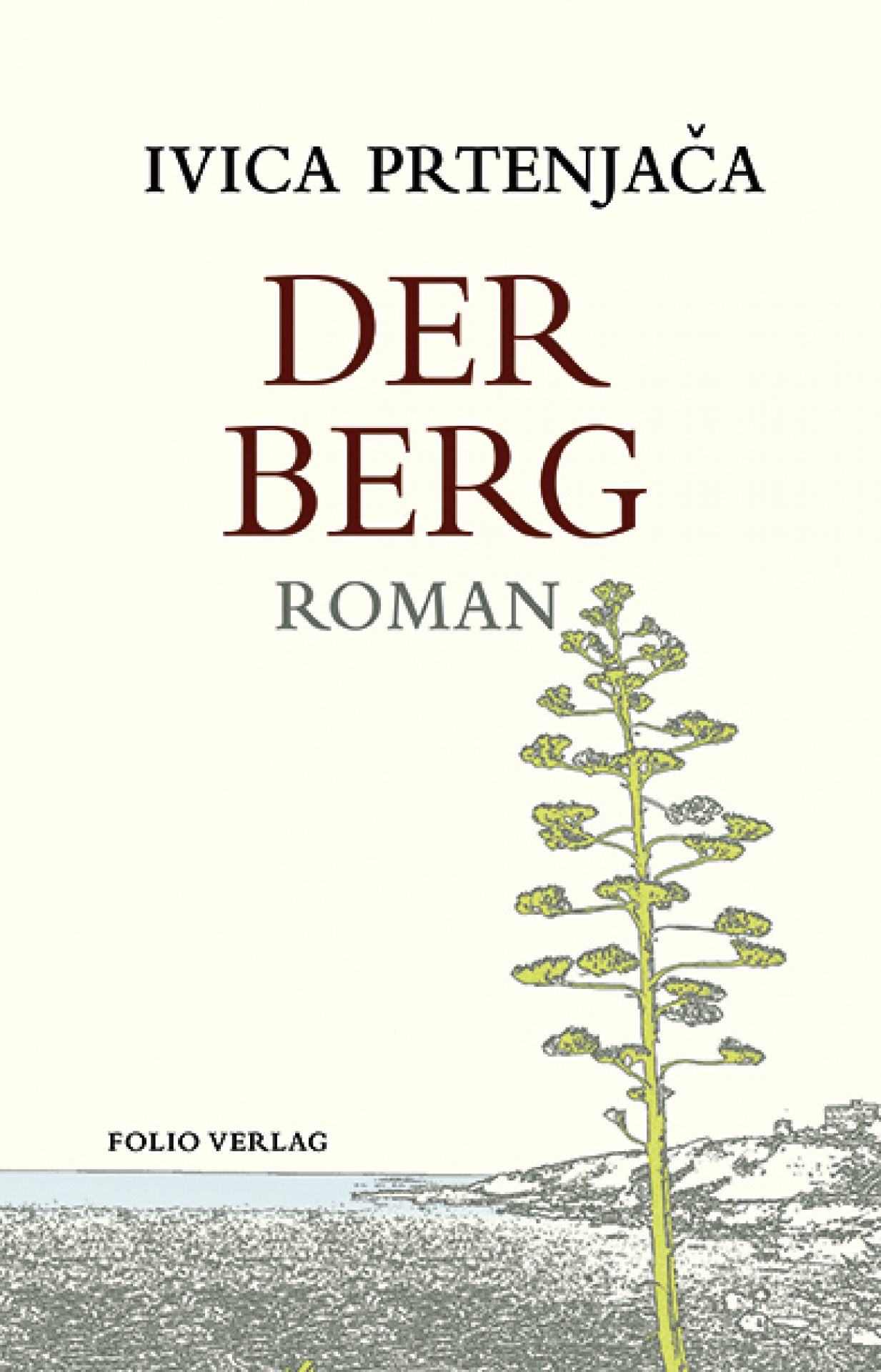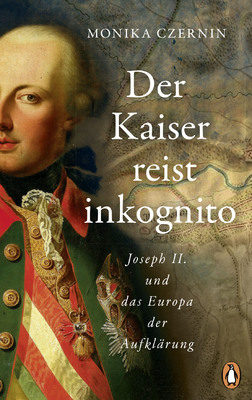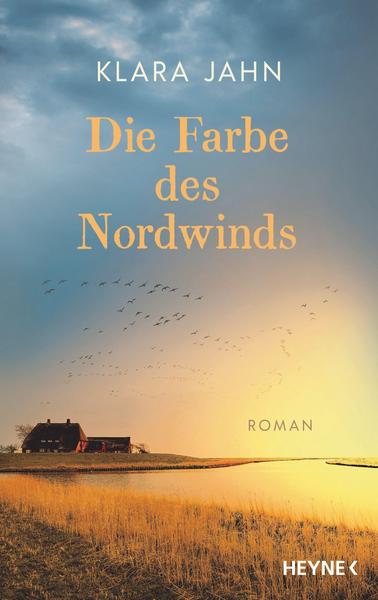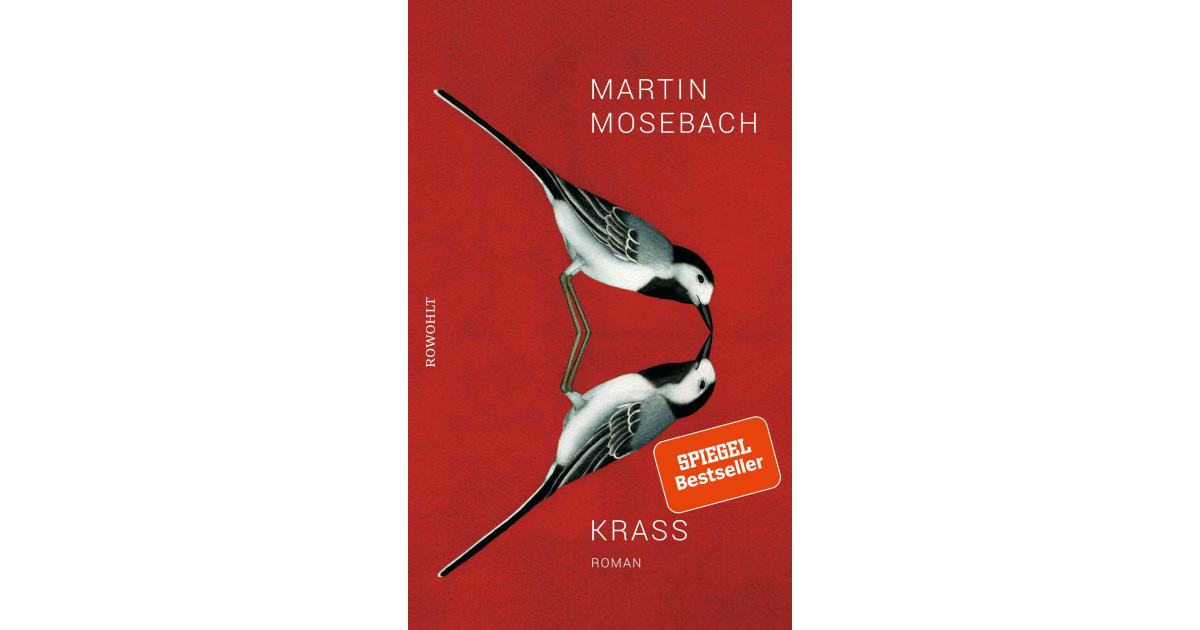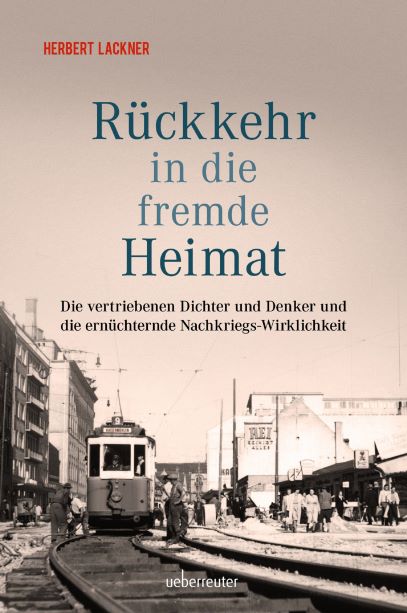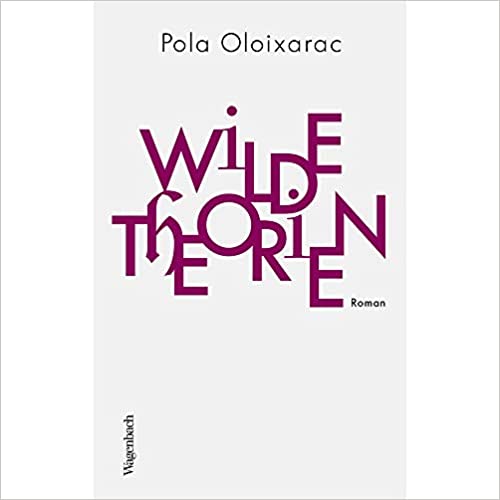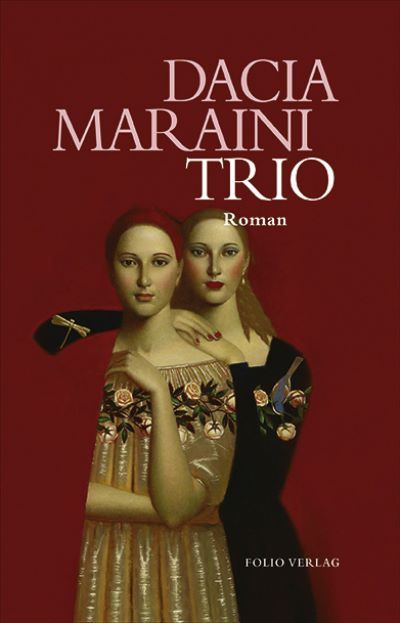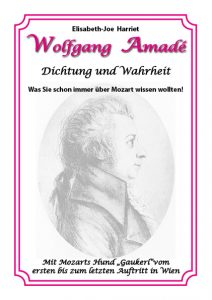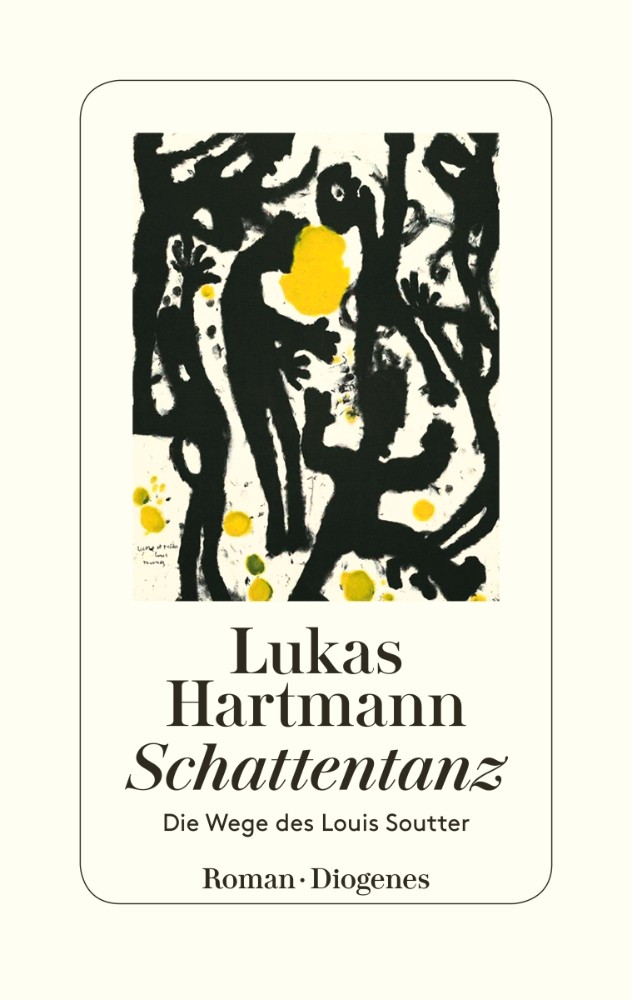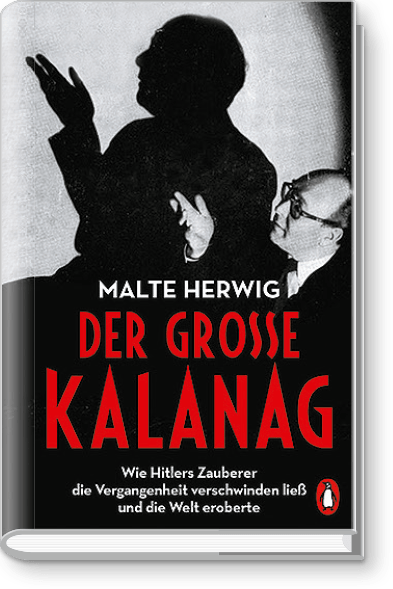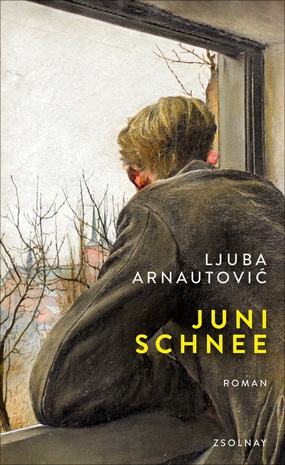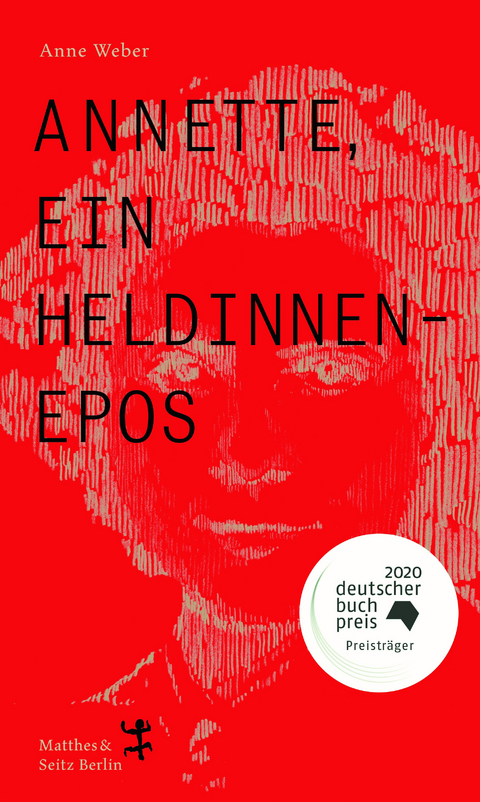Diogenes Verlag
Traurig schließe ich dieses Buch. Traurig, weil es zu Ende ist. So fühle ich mich immer, wenn ich – was selten genug der Fall ist – ein Buch beendet habe, das mich durch Tage gefangen hielt. Eine literarische Kostbarkeit darf nur in kleinen Dosen genossen werden, sage ich und lese immer nur ein Kapitel. Dann lege ich das Buch weg. Lasse Sprache und Bilder, die Hartmann einfühlsam und subtil erstehen lässt, in mir wirken, lese einige Stellen nochmals, um sie besser in mich aufnehmen zu können und lange zu bewahren.
Lukas Hartmann ist kein „Seitenfüller“. Seine Sätze sind jeder für sich kostbar, bildhaft, stark. Banalitäten lässt er nicht durchgehen. Denn die Bilder des Malers Louis Soutter, dessen Leben und Werke Lukas Hartmann auf knapp 250 Seiten beschreibt, waren für ihn „ein künstlerisches Offenbarungserlebnis“, wie er im Nachwort gesteht. Erst nach langer und eingehender Beschäftigung mit diesem Ausnahmekünstler wagte er es, dieses Buch zu schreiben.
Die alles beherrschende Mutter
Louis Soutter (1871 -1942) wächst in einem gut bürgerlichen Haus in Morges am Genfer See auf. Er und seine Schwester Jeanne werden von der ehrgeizigen Mutter zu „Wunderkindern“ gedrillt. Sie sollen als Musiker Weltkarriere machen: Louis als Geigenvirtuose und Jeanne als Sängerin. Beide versuchen immer wieder, sich diesem Zwang zu entziehen. Mit mäßigem Erfolg. Das übergroße Mutterbild wird ihr Leben beherrschen und zum Teil auch ruinieren. Nur der Älteste der drei Kinder, Albert, scheint zunächst davonzukommen. Er übernimmt die Apotheke des Vaters. Doch auch er scheitert und rettet sich in den Suff.
Louis versucht tatsächlich ein Geigenstudium, gibt es aber bald zu Gunsten der Malerei auf. Seine Heirat mit einer reichen Amerikanerin scheitert kläglich, weil er ihren Anforderungen nicht genügen kann. Zurück in der Schweiz, versucht er mit mäßigem Erfolg, sein Geld als Geiger zu verdienen. Aber er spürt, es ist die Malerei, die sein Leben bestimmt. Unfähig, sich selbst zu erhalten, wird er bald in ein Altersheim eingewiesen, wo er 19 Jahre bis zu seinem Tod 1942 bleiben wird. In einem armseligen Zimmer malt er wie besessen. Bilder, die sich ihm aufdrängen. Er kann nicht anders, er muss seine inneren Qualen, seine Visionen vom kommenden Krieg malen.Hellsichtig weiß er, dass Mussolini und Hitler den Tod von Millionen Menschen verursachen werden.
Seine Bilder
Seine Bilder wurden zu Lebzeiten von niemandem geschätzt. Heute werden sie in verschiedenen Museen ausgestellt. Soutter selbst hatte Zweifel, ob sie irgendwem einmal etwas bedeuten werden. Manche Bilder zerreißt er, manche verschenkt er, die meisten stapelt er in seiner Kammer zu großen Haufen. Als seine Augen immer schwächer werden, malt er mit Fingern, lässt sie wie in Trance über das Papier tanzen, einer inneren Musik folgend. Er stirbt 1942 einsam in seiner Kammer, inmitten einer Unmenge von Werken.
Geschickt beleuchtet Lukas Hartmann diesen schwierigen und schwer fassbaren Charakter von verschiedenen Seiten und wechselt den Standpunkt der Betrachter. Einige Male reflektiert die Mutter in der Ichform über ihre Wünsche und Vorstellungen, die sie für die Kinder hatte. Als objektiver Beobachter fungiert ebenfalls der Cousin Charles-Edouard, der später als Architekt Le Corbusier eine intenationale Karriere machen wird. Dass die beiden in Anschauungen und Lebensformen total verschieden sind, wird dem Cousin sehr schnell klar. Dennoch besucht er Louis in Abständen von mehreren Jahren immer wieder, obwohl er mit seinen Bildern nichts anzufangen weiß. Aber die intensiven und sehr kontroversiell geführten Auseinandersetzungen über die Aufgaben der Kunst faszinieren den Cousin.( Dass Hartmann von der kalten Architektur Le Corbusiers nicht sehr viel hält, lässt er dabei deutlich werden) Als glühender Verehrer von Mussolini und Hitler wird Corbusier erst nach dem Tod von Louis dessen Hellsichtigkeit erkennen.
Besonders berührend schildert der Autor das innige Verhältnis zwischen Louis und seiner Schwester Jeanne. Sie ist die einzige aus der Familie, die ihn versteht und versucht, ihm in seiner Lebensuntüchtigkeit Halt zu geben. Die Kindheit der beiden, die, vertieft in Spiele und erfüllt von gegenseitiger Zärtlichkeit, der Härte der Mutter zu entgehen versuchen und sich eine eigene Welt bauen, war nur in diesen Phasen des ungestörten Zusammenseins glücklich. Doch auch Jeanne wird später nicht die nötige Kraft aufbieten, sich gegen die Mutter zu stellen. Sie zerbricht in diesem Kampf und wird Selbstmord beghen.
Das Leben Louis Soutters erinnert in vielen Zügen an den Schweizer Autor Robert Walser (1878-1956). Beide hatten mit den bürgerlichen Lebensformen und den Anforderungen der Gesellschaft an sie schwere Probleme. Beide versuchten im Gehen über weite Strecken ihre innere Unruhe zu bezähmen. Beide fanden in der (unfreiwilligen) Abgeschlossenheit eines Heimes einen gewissen Frieden und schufen wichtige Werke. Auch der Dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843) erlitt ein ähnliches Schicksal: Nach der schmerzvollen Trennung von seiner Geliebten Suzette Gontard und nach deren Tod zerbricht in ihm das Korsett, das ihn bis dahin in einer gewissen bürgerlichen Bahn gehalten hat. Er geht, geht, geht, weit und als er nach Tübingen zurückkehrt, hat sich sein Geist verwirrt, so glaubt man.Nach einer sinnlosen Zwangsbehandlung im Tübinger Klinikum zieht sich Hölderlin bis zu seinem Tod in die Einsamkeit eines Turmes zurück. Und vielleicht darf ich auch Parallelen zu Peter Handke ziehen. Er wählt die Abgeschiedenheit selbstbestimmt. Ebenso wie Soutter und Walser ist ihm das Gehen in der Natur Impuls und schafft ihm inneren Frieden.
All diesen Künstlern gemeinsam ist das innere Brennen für ihre Kunst, das bedingungslose Wollen und Schaffen. Lukas Hartann ist ein congenialer Übersetzer, Vermittler zwischen diesem so schwer fassbaren Künstler Louis Soutter und den Lesern. In der Flut der historischen Biografien, die zur Zeit den Markt überschwemmen, leuchtet dieses Buch als seltener Diamant heraus.
http://www.diogenes.ch