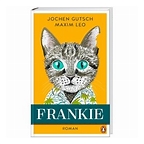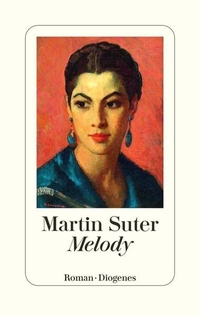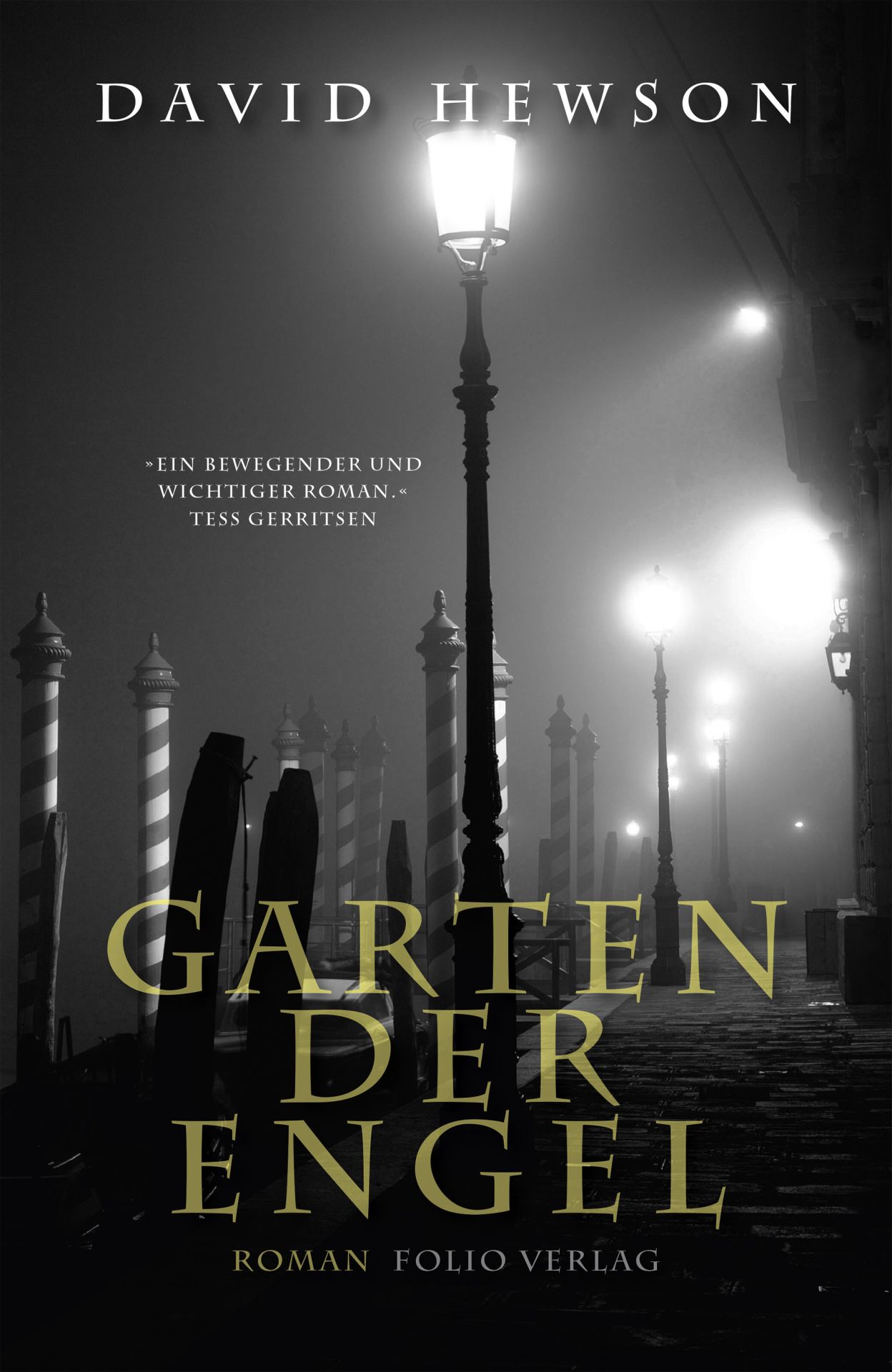John Neumeier: Regie, Choreografie, Bühne, Kostüme und Licht. Kazuki Yamada: Musikalische Leitung.
Hamburg Ballett John Neumeier.Bachchor Salzburg unter der Leitung von Benjamin Hartmann
Maxim Mironov: Orphée, Andriana Chuchman: Eurydice, Lucía Martín – Cartón: L´Amour
Es war ein atemberaubender Abend! John Neumeier, der Grandseigneur des Balletts, übertraf sich selbst und schuf ein in der Ballettgeschichte völlig neues Genre: Die Ballett-Oper. Waren seit der Barockzeit Balletteinlagen das Beiwerk zur Oper, so dreht Neumeier die Wertung um: Die Ballettszenen beherrschten die Szene, die Arien waren die gesanglichen Glanzpunkte.
Wenn John Neumeier einen Ballettabend choreographiert, dann wird es immer ein Meisterwerk, weil er alles, alles, wirklich alles selbst kreiert: Bühnenbild, Licht, Kostüme und Tanz. Man spürt und sieht bis ins kleinste Detail seine geniale Handschrift. Nur so kann das so genannte „Gesamtkunstwerk“ entstehen.
Um dem Mythos von „Orpheus und Eurydike“ zu aktualisieren, wird aus Orpheus ein Ballettmeister. Man probt Szenen zu einem Ballett nach dem Gemälde des Malers Arnold Böcklin „Toteninsel“. Eurydike soll die Hauptrolle übernehmen, kommt aber meist zu spät zu den Proben. Orpheus rügt sie heftig, sie verlässt beleidigt den Saal, steigt in ihr Auto und verunfallt tödlich. Soweit die Transformation in die Gegenwart. Was folgt, ist die bekannte Geschichte: Orpheus steigt in die Unterwelt, um Eurydike zurückzuholen, überzeugt die Götter der Unterwelt durch seinen Gesang. Doch sie wird nur wieder lebendig, wenn er sich während des Ganges zur Oberwelt nicht nach ihr umdreht. Das Ende ist bekannt. Eurydike stirbt ein zweites Mal.
Staunend erlebt man, wie Neumeier keine Scheu hat, Totenreich und Elysium in Bild und Tanz darzustellen. Die düstere „Toteninsel“ öffnet sich zu großen Spiegeln, Dämonen tanzen einen animalischen Tanz um Orpheus, er aber schreitet angstlos weiter ins Elysium, wo im Hintergrund Eurydike erscheint. Er will sie so schnell wie möglich in die Oberwelt zurückführen. Immer an die Mahnung denkend, dreht er sich nicht um, sondern treibt Eurydike zur Eile. Sie, ein wenig raunzend, dann fast keifend, schließlich eifersüchtig quengelnd zweifelt an seiner Liebe. Als Orpheus, sie tröstend, sich umdreht, entschwindet sie ihm.
Im letzten Akt ist es die zauberhafte Figur L`Amour, die ihn tröstet und erinnert, dass die Kraft der Liebe Eurydike in Vision und Gedanken zurückkehren lässt und ihn für immer beseelen wird.
Maxim Mironov ist die Idealbesetzung. Seine Stimme umfasst mühelos die Höhen des Tenors und die Tiefen eines Baritons. Seine Arien , besonders die berühmte: „J´ai perdu mon Eurydice“ erhielten langen Applaus. Bezaubernd auch Luzía Martín Carton als L´Amour, zuerst seine Assistentin, dann seine „Psycha-gogin“, seine Seelenbegleiterin durch die Unterwelt, und letzlich seine Retterin aus den Untiefen der Verzweiflung. Die schwierige Rolle der Eurydike meisterte Andriana Chuchman bravourös. Schwierig deshalb, weil sie keine „hehre“ Eurydike darstellen sollte, sondern eher eine an der Liebe Orpheus` immer zweifelnde, leicht zickige Ehefrau. Unbedingtes Lob und viel Applaus galten auch dem hervorragenden Bachchor, der – aus dem Orchestergrabend singend – die Szenen in der Unterwelt und Elysium begleitete. Nicht zu vergessen natürlich, die hervorragenden tänzerischen Leistungen des Hamburger Balletts, allen voran das Paar Edvin Revazov und Anna Laudere, die als Schatten von Orpheus und Eurydike wunderbare Pas de deux tanzten.
Frenetischer Applaus und lange standing ovations für John Neumeier. Das Publikum ehrte ihn für sein Gesamtkunstwerk. Denn ihm gelang, was dem Theater der Gegenwart oftmals abhanden kommt: Ein Theater fernab von Polittheater, „moralischer Erziehungsanstalt“ etc. Frei von „Erziehung“ darf sich das Geschehen entwickeln. Das Publikum taucht ein in die Phantasie Neumeiers, der es von der Oberwelt in die Unterwelt und das Elysium führt, ganz ohne Scheu, das Unsagbare und Unzeigbare sicht- und spürbar zu machen. Der Alltag hört auf zu existieren, die Kunst übernimmt die Rolle, die sie seit jeher hatte: In eine andere Welt zu entführen und die Magie wirken zu lassen.
http://www.salzburfestival.at